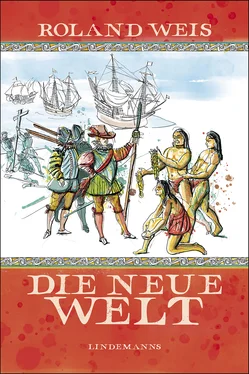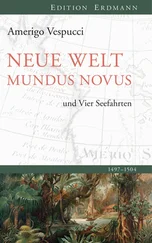Rodrigo beugte sich über die Reling: „Unkraut!“, rief er erschrocken aus. „Da schwimmt jede Menge Unkraut auf dem Meer, sieht aus, wie eine riesige Spinatsuppe.“
Lope Chips rieb sich nachdenklich das stoppelbärtige Kinn.
Rodrigo blickte abwechselnd hinunter auf die vielen Bündel grünen Krauts und auf das zerknitterte und wettergegerbte Gesicht des Kalfaterers. Doch der schweigsame Baske schien genauso verblüfft. Er hatte schon viel erlebt, in seinem Seefahrerleben, aber grünes Kraut mitten im Meer?
Inzwischen bestaunte auch die übrige Mannschaft die schwimmenden Grasflächen, die steuerbords wie backbords an der Santa Maria vorüberzogen. Wie ein unter Wasser gesetztes Kleefeld schaukelten die grünen Matten in den Wellen. Immer mehr Pflanzen breiteten sich auf der Meeresoberfläche aus, und die Schiffe fuhren mitten hinein. Alle Mann versammelten sich in Gruppen an der Reling und diskutierten die ungewöhnliche Erscheinung.
„Algen“, vermutete José Pequinos.
„Seegras“, widersprach Chachu. „Es sieht aus wie Seegras.“
Der wieder genesene Jacomo Rico kam mit nacktem Oberkörper herbeigeturnt und balancierte elegant wie ein Zirkuskünstler eine am Seil gesicherte lange Stange mit Haken über das Deck.
„Hier!“, rief er. „Wir holen mal eine Ladung an Bord. Heda, achtern, aufgepasst, zieht die Köpfe ein!“
Er schwenkte seinen Staken über die Reling und hangelte zu den Wellen hinunter. Tatsächlich verfing sich schnell eine größere Menge des Krauts im Haken. Doch als Jacomo das Bündel an Bord hieven wollte, stellte sich heraus, dass die einzelnen Grasbüschel untereinander durch lange Fasern verbunden waren. So hingen größere Mengen an einem Stück zusammen, und drei Mann mussten Jacomo Rico helfen, die Stange wieder an Deck zu ziehen. Es hatte sich ein über mannsgroßer Klumpen Kraut und Blätter daran verfangen, vollgesaugt mit Wasser und so schwer, dass der übermütige Lockenkopf seinen Fang alleine gar nicht bergen konnte. Schließlich rissen die Fasern der miteinander verflochtenen Wasserwurzeln, und das ganze Grünzeug lag vor ihnen auf den Decksplanken. Das Gras schimmerte matt in einer weißlichen oder fahlen Farbe wie welkes Heu. Kleine weiße Beeren hingen an den Stengeln. Auf Deck wirkte das Grünzeug stumpf; es sah viel saftiger und viel grüner aus, wenn es im Wasser schwamm.
Chachu schob ein Bündel mit den Zehen auseinander, die anderen standen im Kreis darum herum. Schiffsarzt Sanchez gesellte sich mit interessiertem Gesichtsausdruck dazu. Er kniete sich nieder und nahm das Seegras in Augenschein: „Irgendwie sieht das Zeug aus wie unsere Gartenraute, schaut euch nur die Blätter an.“
Dann nahm er eines der kleinen Beerenkörnchen, die an den Krautbüscheln hingen, zwischen die Finger und drehte es sorgfältig prüfend.
„Beißt doch mal rein, Maestro!“, schlug Jakob vor. „Vielleicht schmecken sie ja.“
Der große Krautklumpen wurde zerfleddert. Jeder zog sich ein Stück heraus, untersuchte die Fasern und Blätter, die runden Körnchen, die denen des Wachholderstrauchs ähnelten, die Männer rochen daran, schnupperten skeptisch, bissen hinein, zerschnitten es mit ihren Messern, bis es in Fetzen lag. Im anatomischen Institut von Sevilla hätte man die Sache kaum gründlicher angehen können. Der Admiral legte Gleichmut an den Tag. Er lehnte sich über die Reling und beobachtete den Vorüberzug der Grasmatten. So weit das Auge reichte sah man überall kleinere und größere Grasinseln, an manchen Stellen wuchsen sie zu beachtlichen Teppichen von mehr als drei oder vier Schiffslängen zusammen.
Colón kletterte, nachdem er gebührende Zeit hatte verstreichen lassen, vom Achterkastell herunter und hob zu einer seiner Ansprachen an: „Männer, dankt dem Allmächtigen, der schützend und mit Wohlwollen unsere Wege lenkt. Denn dies hier ist ein gutes Zeichen nahen Landes. Solches Algengras braucht Land um zu wachsen. Also ist Selbiges nicht fern. Ich vermute, dass ein Sturm die Grasbüschel von einer Felsenküste losgerissen hat, so dass sie hier nun auf dem Meer treiben.“
Der königliche Schreiber Escobedo legte es bei jeder Gelegenheit auf Widerspruch an: „Wenn Land nicht weit ist, warum segeln wir dann nicht hin, Adelante?“, rief er von der anderen Seite des Schiffes her. Dort stand der knochige Notar selbstgefällig mit seinem Kumpan Pedro Gutierrez an der Reling und hörte Colón mit schiefem Grinsen zu.
Der Admiral entgegnete höflich, mit jenem Unterton von nachsichtiger Geduld, welche man begriffsstutzigen Kindern entgegenbringt: „Es ist nicht jenes Land, welches wir suchen, Señor Escobedo. Wir wollen nach Zipangu, habt Ihr das vergessen? Was sollen wir auf irgendwelchen unbewohnten Inseln mitten im entlegenen Ozean?“
Gutierrez schob seinen Wanst in den Vordergrund und mischte sich ein, ganz die Stimmung der Mannschaft treffend: „Herr, wir haben zehn Tage kein Land mehr gesehen. Wieso sollen wir nicht nach jenen Inseln suchen, von denen dieses Kraut sich losgerissen hat? Wir könnten unsere Vorräte auffrischen und das Trinkwasser erneuern. Und wir könnten mal wieder festen Grund unter den Füßen spüren.“
Colón wandte sich an Gutierrez: „So redet nur eine Landratte daher. Unsere Vorräte bedürfen keiner Auffrischung, ebenso wenig unser Trinkwasser. Erst gestern hat es geregnet. Wir vergeuden nur kostbare Zeit, wenn wir hier nach unbedeutenden Inseln suchen.“
Der dicke Repostero Real ließ nicht locker: „Und wenn es das Festland ist, das wir suchen? Was, wenn Zipangu schon in der Nähe ist, mit dem großen Khan und all seinen Schätzen und Reichtümern?“
„Das ist so gänzlich ausgeschlossen, Señor Gutierrez, dass ihr euch solche Träume aus dem Kopf schlagen könnt“, erwiderte Colón, jetzt bereits leicht ungehalten. Er wandte sich wieder an die ganze Mannschaft, die sich inzwischen zu einem Halbkreis um ihn versammelte und aufmerksam zuhörte. Der Admiral ließ eine seiner kategorischen Behauptungen folgen: „Ich habe genaue Berechnungen und auch geheime Karten, wonach sich in diesen Breiten eine Menge unbewohnter, kleiner Inseln befinden. Von ihnen kommt dieses Beerenkraut. Aber sie sind unbedeutend und liegen verstreut. Vielleicht werden wir sie auf unserem Rückweg ansteuern. Dann werden wir sehen, ob sie eventuell geeignet sind als Stützpunkt für die Schiffe und Flotten unserer Majestät, König Ferdinand, so sie künftig zwischen Spanien und den indischen Landen verkehren. Aber jetzt, wo wir erst den Seeweg nach Indien zu finden trachten, verlieren wir keine Zeit mit der Suche nach diesen Inseln, so verlockend das auch mancher ängstlicheren Natur in der momentanen Lage erscheinen mag. Darum lasst uns weitersegeln nach Indien.“
Woher Colón die Dreistigkeit nahm, solchen Unfug zu erzählen, blieb sein Geheimnis. Jedenfalls wirkte die Medizin. Es erhob sich kein Widerspruch mehr. Aber in den meisten Gesichtern spiegelte sich Skepsis.
In dieser Nacht beschäftigte Rodrigo die Vorstellung von unbekannten und möglicherweise unbewohnten Inseln unmittelbar in ihrer Nähe, wie sie auf des Admirals geheimen Karten angeblich eingezeichnet waren.
„Meister de La Cosa“, plagte er deshalb unmittelbar nach Beginn der Frühwache den Piloten, „was denkt Ihr, was es mit den Inseln auf sich hat, die hier im Meer verstreut liegen?“
Der Kapitän schnaufte und drehte sich widerwillig zu Rodrigo hin. Er hatte in den Sternenhimmel geträumt, vielleicht von einer Geliebten im fernen Galicien. Rodrigos Fragerei war ihm lästig: „Was weiß ich, welche Inseln es sind. Es wären ja keine geheimen Karten mehr, wenn jedermann davon wüsste. Es gibt viele Eilande im atlantischen Ozean, von denen man nicht viel mehr kennt als sagenhafte Berichte. Vielleicht ist es Antilia, die Insel mit den sieben goldenen Städten, oder Brasil, nach der der englische Kapitän Tloyde vor zwölf Jahren schon gesucht hat, oder es ist die Insel des heiligen Sankt Brendan?“
Читать дальше