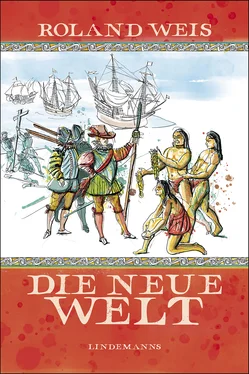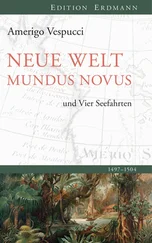Neben diesem wies an Bord noch ein zweiter Kompass die Richtung, der Steuer-Kompass. Er befand sich, alleine für den Gebrauch des Steuermannes, direkt neben der Ruderstange. Selbstverständlich verwahrte der Admiral weitere Reserveinstrumente und Nadeln in seiner Toldilla.
All dies erfuhr Rodrigo bereits in seinen ersten Tagen als Schiffsjunge. Vieles erklärte ihm Pablo, der viel schneller als Rodrigo begriff, wie das Schiff gesteuert wurde: Mit dem großen Außenbordruder, das mit einer hölzernen Ruderpinne verzapft war, konnte der Pilot den Kurs nach Belieben ändern. Am Vorderende der Ruderpinne, da wo der Rudergänger stand, erleichterten die Flaschenzüge der Entlastungstaljen jede Bewegung der Ruderstange. Selbst die Schiffsjungen konnten ohne großen Kraftaufwand das Steuerruder bewegen. An der Stelle, an der die Ruderpinne am Außenruder befestigt war, klaffte eine große Öffnung im Heck des Dreimasters, durch die gelegentlich auch Wellen hereinzüngelten, wenn das Schiff vor schwerer See herlief.
Der Rudergänger stand unten drin im Poopdeck und sah aus dieser Position von Segel, See und Himmel nichts. Er steuerte den Kurs nach seinem Steuer-Kompass und nach dem Gefühl, das ihm das Schiff gab. Außerdem stand über ihm auf dem Achterkastell der wachhabende Offizier, der die nötigen Befehle und Kursänderungen hinunterrief.
Nicht jeder durfte an die Ruderpinne, jedenfalls nicht, solange der Admiral in der Nähe stand. Aber in den langen Nachtwachen, besonders in der Grabeswache von Mitternacht bis vier Uhr morgens, stellte der Rudergänger schon mal einen der Schiffsjungen hin, um sich selbst ein Nickerchen zu gönnen. Es konnte bei gleichbleibendem Kurs und Wind nicht viel passieren. So meinte man.
Jedermann an Bord kam an beiden Kompassen an Deck täglich mehrfach vorbei und warf dabei gewohnheitsmäßig einen Blick darauf. So konnten die Matrosen selbst den Kurs kontrollieren, was viele auch eifrig taten. Allerdings gab es nicht viel abzulesen auf den Kompassscheiben, und welcher Matrose konnte schon lesen? Es waren weder die Namen der Winde noch die Anzahl der Grade oder die Abkürzungen für die Windrichtungen aufgeführt. Auf der Kompassscheibe stand nichts von alledem. Um die verschiedenen Richtungen voneinander zu unterscheiden, orientierte man sich an der Breite, der Form und der Farbe der verschiedenen Dreiecke, Rauten und Pfeile. Diese Zeichen kannte jeder auswendig. Nur der Norden war anders markiert, nämlich mit einer Lilie als unveränderlichem Symbol.
Mit viel Geduld erklärte Schiffseigner Juan de La Cosa Rodrigo und Pablo das Prinzip und die Bedeutung der einzelnen Zeichen. Zeit dafür gab es im täglichen Einerlei des Segelns genug. Dem erfahrenen Seemann schien es Spaß zu machen, vielleicht genoss er auch die unverblühmte Bewunderung, welche die Jungen vom ersten Tag an für ihn hegten. Obwohl Rodrigo bald all diese Einzelheiten begriffen hatte, fand er längst nicht den gleichen Gefallen wie Pablo daran. Für Rodrigo galt: Hauptsache die Santa Maria segelte, Hauptsache es gab täglich genug zu essen, niemand verprügelte ihn. Bei Pablo hingegen konnte es passieren, dass er zu Füßen des baskischen Besitzers der Santa Maria saß, dem Haudegen staunend zuhörte und davon träumte, selbst einmal als Kapitän eines Schiffes über die Meere zu segeln. Vollbeladen mit Schätzen und Reichtümern!
Am Dienstagnachmittag, 11. September, herrschte wieder einmal Aufregung auf der voraussegelnden Pinta. Die Mannschaft auf dem Schiff von Kapitän Martin Alonso Pinzon hatte irgendetwas entdeckt, was im Meer trieb. Über den großen Sprechtrichter und ein Rauchzeichen der Fumos machten die Pinta-Leute die Santa Maria darauf aufmerksam. Alle Mann stürzten an die Reling und starrten in die Wellen: Da nur leichter Seegang herrschte, erkannten alle das hölzerne Wrackteil, ein schwerer Maststumpf.
Juan de La Cosa ließ beidrehen. Der Admiral kam dazu und auch Peralonso Niño. Rodrigo, der nur ein paar Schritte von den hohen Herren entfernt stand, hörte, wie die drei sich über das Treibgut unterhielten.
„So wie das aussieht, gehörte der Mast zu einem größeren Schiff. 100 Toneladas würde ich schätzen“, sagte Juan de La Cosa.
„120 Toneladas“, bestimmte der Admiral. Niemand widersprach. Rodrigo begutachtete den abgebrochenen Mastbaum, der sich in geringer Entfernung an der Santa Maria vorbeiwälzte. Was musste das für ein mächtiges Schiff gewesen sein. Die Santa Maria brachte es auf gerade 100 Toneladas, Niña und Pinta auf je 60. Auch das gehörte zu den Dingen, die Rodrigo gelernt hatte: Mit dem Laderaum, der einem Schiff für den Transport kastilischer Weinfässer, Toneladas, zur Verfügung stand, bezeichneten die Seeleute die Tragfähigkeit ihrer Schiffe.
Der auf den Wellen vorbeitreibende Mast sah ramponiert aus und war erkennbar schon lange im Wasser. Ein paar Matrosen, die Baskenfreunde von Chachu dem Bootsmann, versuchten das Monstrum mit Haken und Tauen einzufangen. Aber der Versuch schlug fehl. Die Santa Maria machte noch zuviel Fahrt und der mächtige Stumpf torkelte an ihnen vorbei ins Kielwasser, wo er schnell wieder in den Wellen verschwand.
Rodrigo stand gerne dabei, wenn Pablo den Herren Offizieren mit Fragen auf die Nerven ging, die oftmals weit über den Seemannsalltag hinaus gingen: „Wie tief ist das Meer, Meister de La Cosa?“
Der Kapitän runzelte die Stirn. Pablos Frage gefiel ihm nicht. „Nimm das Lot und miss es nach!“, empfahl er mürrisch.
Pablo nahm sich den Matrosen José Pequinos zu Hilfe: „Hast du schon einmal gemessen, wie tief das Meer ist?“
Wie jeder weitgereiste Seemann, so hielt auch José Pequinos sofort einen unerschöpflichen Fundus von Geschichten und Erklärungen parat: „Das ist ganz unterschiedlich, mein Junge. Nähert man sich einem Hafen oder einem Ankerplatz, dann kann man die Leine auslaufen lassen, bis das Lot den Boden gefunden hat.“ Pequinos wettergegerbten, rissigen Hände spielten mit der Schnur und dem daran befestigten Bleikegel – er ließ beides durch die Finger gleiten: „Wenn das Lot aber auf keinen Grund stößt, was ist dann? Ich bin der Meinung, dass es gänzlich unmöglich ist, auf den Ozeanen irgendwo Grund zu finden, selbst wenn wir alle Leinen der Welt aneinanderknüpfen sollten.“
Rodrigo hörte ungläubig zu. War Wasser nicht überall gleich? Spielte es eine Rolle? Die Schiffe segelten, egal wie tief das Meer unter ihrem Kiel reichte.
Jacomo Rico, der kraushaarige, immer fröhliche Leichtmatrose, mischte sich ein, besserwisserisch, wie es seine Art war: „Das ist nicht wahr, José!“, verbesserte er Pequinos. „Was ich selbst erlebt habe ist, dass man mit dem Lot die Gegenden und Länder bestimmt, in denen man sich gerade befindet. Man wirft das Lot und wartet, welchen Grund es mit heraufbringt. Ist es Schlamm, dann sind wir in Venedig oder Genua, meiner Heimat.“ Er lächelte stolz und entblößte dabei seine weißen Zähne. „Bringt der Lotkegel aber Kies mit herauf, dann ist das guter Ankergrund und wir sind vielleicht vor der Bretagne. Wenn nichts mit heraufkommt, dann ist der Grund felsig und das deutet auf afrikanisches Gewässer hin.“ Jacomo Rico äußerte seine Überzeugungen mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein.
Pequinos schüttelte nur den Kopf: „Das kann nur ein Genuese erzählen, der noch nie über Gibraltar hinausgekommen ist.“
Am Morgen des 13. September, eine Woche nach der Ausfahrt aus dem Hafen von San Sebastian auf La Gomera, blieb der Admiral länger als üblich an der Bitacora stehen. Rodrigo stand nahe dabei und sah, wie Colón mehrfach den Kopf schüttelte. Auch La Cosa fiel das Zögern des Admirals auf und er trat näher an Colón heran. „Was ist los, mein Herr?“
Christóbal Colón reckte seine hagere Gestalt, atmete tief ein und schloss die Augen, wie in stiller Andacht. Dann blickte er auf den Kompass und schüttelte erneut den Kopf: „Ich glaube ich träume, La Cosa! Wüßte ich nicht, dass der Allmächtige schützend die Hand über mich hält, müsste nun auch ich den Mut verlieren. Schaut Euch den Kompass an, Señor Kapitän!“
Читать дальше