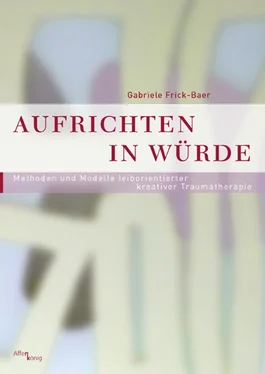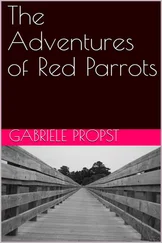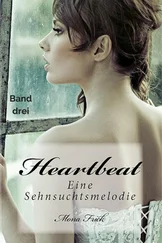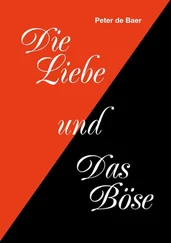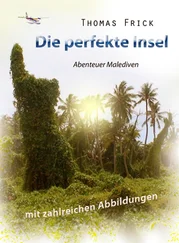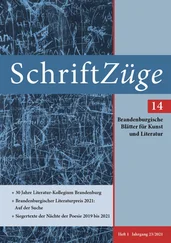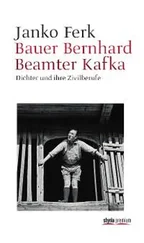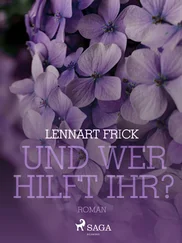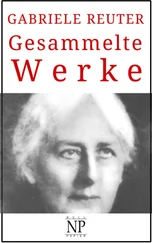Es sind gerade am Anfang der therapeutischen Begegnung häufig nicht Symptome des Posttraumatischen Stresssyndroms oder sonstige offenkundige „Traumathemen“ (wie gestörte Sexualität, Flashbacks, Schlaflosigkeit, Ängste …), die im Erzählen der Klient/innen im Vordergrund stehen, sondern oft „harmloser“ und alltäglicher daher kommende Phänomene, die allerdings nichtsdestoweniger im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Trauma stehen und die Qualitäten des Traumaerlebens beleuchten.
Das häufigste, worüber traumatisierte Klient/innen nach meinen Erfahrungen in einem Erstgespräch klagen, ist ihr mangelndes oder fehlendes Selbstwertgefühl. Dies äußert sich im Großen wie im Kleinen, bei besonderen Herausforderungen des Lebens wie im Alltag. Selbstverständlich ist der Umkehrschluss unzulässig, dass mangelndes Selbstwertgefühl immer oder meistens auf traumatische Erfahrungen schließen lässt. Doch auf der Skala der Phänomene, an denen Menschen mit Traumata leiden, scheint mir das geringe Selbstwertgefühl die „Nummer 1“ zu sein. Mögen es manche Klient/innen auch hinter scheinbar selbstsicherem Auftreten oder beruflichem Erfolg verbergen, so ist die Selbstverunsicherung und oft Selbstabwertung doch das, was sie innerlich erleben. Wenn der innere Kampf dagegen und die Anstrengung, diesen Spagat aufrechtzuerhalten, zu groß und zu auslaugend werden, führt dies oft zum Schritt in die Therapie.
Dass das Selbstwertgefühl bei Opfern traumatischer Erfahrungen und insbesondere sexueller Gewalt gemindert und gestört ist bzw. als zerstört erlebt wird, ist nachzuvollziehen. Sexuelle und andere Gewalt gehen über die persönlichen und intimen Schutzgrenzen hinweg und behandeln Menschen als Verfügungsmasse ohne Eigenwert. Etwas davon bleibt in Menschen zurück. Mit den solchen traumatischen Situationen innewohnenden Gefühlen der Hilflosigkeit und Ohnmacht verbunden bleibt das Erleben der Wertlosigkeit zurück.
Das Gefühl der Unverletzlichkeit und Geborgenheit, das behütete Kinder haben und sie im Idealfall auch als Erwachsene als Grunderfahrung durchs Leben begleitet, wird durch sexuelle Gewalt und andere traumatische Situationen brutal gebrochen. Dieser Schock verunsichert und diese Verunsicherung bleibt über die traumatische Situation hinaus. Der innere zentrale Ort, von dem aus Menschen Entscheidungen treffen und Bewertungen, auch Selbstbewertungen, vornehmen, wird zumindest gefährdet, meist geschädigt (s. Kap. 3.2.2).
Oft wirkt diese Schädigung und Verunsicherung so tief, dass Klient/innen mit traumatischen Erfahrungen häufig davon erzählen, dass sie „verrückt sind“ oder „Angst haben, verrückt zu werden“. Dies ist Ausdruck der existenziellen Verunsicherung durch die traumatische Situation, die ja zumeist das Leben und die Lebenssicht der Betroffenen „verrückt“ hat. Dies ist oft auch Ausdruck davon, dass die meisten Betroffenen von Triggern, also meist kleinen (im Sinne von: unauffällig daherkommenden) sinnlichen Eindrücken (ein Geruch, ein Geräusch, ein Blick …), an die traumatische Situation erinnert werden und mit Angst oder Starre, Zorn oder Fluchttendenzen, Zittern oder hoher Erregung, mit dem Erleben, „neben sich zu stehen“ usw. reagieren. Sehr oft vollziehen sich solche Reaktionen unbewusst und bleiben für die Menschen selbst unerklärlich. Die einzige Erklärung, die sie haben, lautet dann: „Ich werde (oder bin) verrückt.“
Ein weiteres häufig angeführtes Phänomen im Vorfeld des traumatherapeutischen Prozesses ist die Schwierigkeit m Umgang mit „Nähe und Distanz“. Gemeint sind zumeist die Schwierigkeiten in sozialen Kontakten und Beziehungen. Das reicht von den Problemen in (Ehe-)Partnerschaften, die sich oft als Lebensarrangements zweier Unerreichbarer darstellen, bis zu den Problemen, sich „überhaupt an andere heranzutrauen“. Manche Menschen sind vereinsamt, andere haben viele Kontakte, ohne dass ihnen die ersehnte Liebesbindung gelingt. „Im Nebel zu sein“, „eine Wand zwischen sich und anderen Menschen zu spüren“, „abgeschnitten zu sein“, eine „Glasglocke um sich herum zu haben“: So oder so ähnlich sind die Bilder, die diesem Erleben Ausdruck verleihen. Auch für dieses Phänomen liegt die Verbindung zum Traumaerleben nahe: Sexuelle Gewalt ist ein Beziehungsakt, eine Beziehungstat. Dieser kann bzw. muss Folgen für das künftige Beziehungserleben haben, unabhängig davon, wie sich die Folgen im Beziehungserleben der Einzelnen äußern. Da die meisten Taten sexueller Gewalt innerhalb der Familie oder von anderen sehr nahe stehenden Personen begangen werden, ist der Bruch des Vertrauens besonders groß – ebenso die Schwierigkeit, wieder Beziehungsvertrauen aufzubauen.
Sich dennoch darum zu bemühen und trotz der Angst, verrückt zu sein, und der oft existenziellen Verunsicherung des Selbstwertgefühls darum zu kämpfen, den Alltag mit Arbeit und manchmal Familie bewältigen zu können, ist anstrengend und macht Druck, großen Druck. Von diesem Druck berichten die Klient/innen häufig in der ersten therapeutischen Begegnung. Sie fühlen sich schwer und angespannt (s. Kap. 3.5) und haben oft jedes Maß für das, was sie leisten, verloren. Was sie leisten, ist nie genug. Sie können sich nie oder nur für kurze Zeit nach Geleistetem oder Erledigtem entspannen, es muss gleich weiter gehen. Sie erleben sich v.a. in Phasen der Tatenlosigkeit als Versager/innen, die zum einen wieder mal nicht alles geschafft haben, was sie hätten schaffen müssen, und zum anderen nicht einmal fähig sind, zu entspannen. Ein erlebter Teufelskreis. Er ist bei Klient/innen mit traumatischen Erfahrungen ein Hinweis darauf, welche Lasten sie oft seit Jahren mitschleppen.
Genauer können sie diese Lasten und ihren Ursprung zumeist nicht benennen. Falls sie den Zusammenhang mit ihrem Trauma überhaupt kennen, so hindert sie doch oft die Scham daran, davon zu erzählen. Auch das Schweigegebot bzw. Redeverbot, mit dem es vielen Täter/innen gelang, die sexuelle Gewalt im Verborgenen zu halten, und die damit verbundenen Drohungen wirken oft nach und lassen verstummen. Auch die Erfahrungen vieler Opfer sexueller Gewalt, dass sie mit dem, was sie erlebt und erlitten hatten, danach oft allein gelassen wurden, sind wirksam und nachhaltig und lassen verstummen. Also bedarf es bei vielen Klient/innen erst des Aufbaus einer vertrauensvollen Beziehung, bis sie von ihren traumatischen Erfahrungen erzählen können.
Das Verstummen führt in den ersten therapeutischen Begegnungen oft zu solchen Äußerungen wie: „Wie es mir geht? Das weiß ich nicht.“ Oder: „Ich weiß nicht genau, was ich hier will.“ Oder: „Ich weiß nicht, was heute Thema ist.“ Wenn ich dann z. B. bitte, das „Ich weiß nicht“ einmal musikalisch mit einem Instrument auszudrücken, und wenn die Klientin oder der Klient nach verwundertem Zögern dies versucht, dann werden oft Spuren dessen hörbar und deutlich, was in der traumatischen Situation dissoziiert wurde. Im traumatischen Erleben sind die Betroffenen oft Unaushaltbarem ausgesetzt. Sie wehren sich dagegen, halten aus, indem sie Teile des Erlebens dissoziieren, aus ihrem bewussten Erleben abspalten (s. Kap. 3.9). Das Unaushaltbare wurde gleichsam begraben – doch die Erde bebt. Sonst wären sie nicht in der Therapie.
Was dieses Beben besagt und was es hervorruft, dafür haben sie keine Worte. Das „Ich weiß nicht“ ist Ausdruck der Dissoziationen und des Zwiespalts zwischen dem Dissoziieren und dem Spüren, „dass da was ist“.
2.2 Traumatische Situationen und Phasen des Traumaerlebens
Das Wort Trauma stammt aus dem Alt-Griechischen und bedeutet „Wunde“. Die Bezeichnung „Trauma“ wird in der Medizin für bestimmte körperliche Wunden benutzt, in Psychologie und Psychotherapie für bestimmte seelische Verletzungen. „In einer ersten Arbeitsdefinition können wir psychisches Trauma als seelische Verletzung verstehen (von dem griechischen Wort Trauma = Verletzung). Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden.“ (Fischer, Riedesser 1999, S.19)
Читать дальше