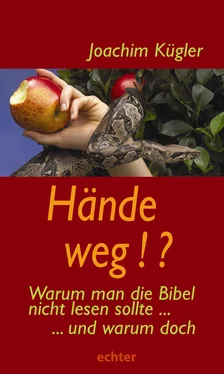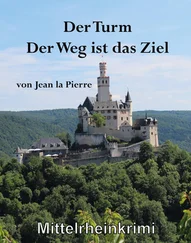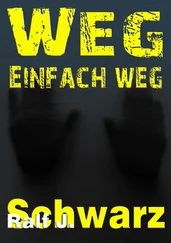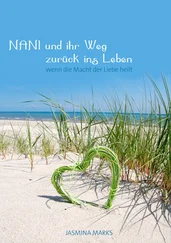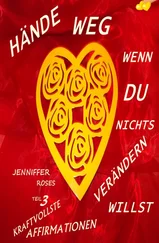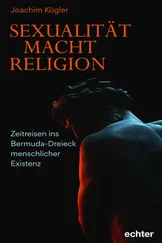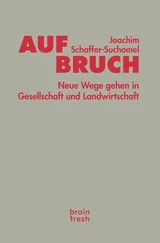Im Alten Testament bilden die fünf „Bücher Mose“ (auch „Pentateuch“ genannt) das Kopfstück, mit dem man beginnen soll. Diese fünf Bücher haben im Judentum (und auch in der Sicht der urchristlichen Gemeinden) einen besonderen Status. Sie bilden als „Tora“ (göttliche Weisung/Gesetz) das Herzstück der Bibel, von dem her alles andere zu verstehen ist. Und die Samaritaner – eine israelitische Sondergruppe, die sich vermutlich nach der Zerstörung des Nordreiches Israel (722 v. Chr.) aus den überlebenden Bevölkerungsgruppen bildete – erkennen bis heute sogar nur den Pentateuch als Heilige Schrift an, während ansonsten im Judentum „die Propheten“ (dazu gehören neben den Prophetenbüchern auch die Bücher Josua, Richter usw.) und „die Schriften“ (z.B. Psalmen, Rut und Chronikbücher) als Kommentare zur Tora anerkannt sind.
Im Neuen Testament empfehlen sich die einzelnen Evangelien als Leseeinheiten. Viele kennen die Evangelien ja nur als Häppchen (auch „Perikopen“ genannt), die man aus dem Religionsunterricht oder dem Sonntagsgottesdienst kennt: die Seligpreisungen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, den Schatz im Acker, die Heilung des Bartimäus, den kleinen Zachäus, den Einzug in Jerusalem usw. Aber von ihrer Struktur her sind Evangelien nicht einfach Anhäufungen von einzelnen Sprüchen und Jesus-Anekdoten, sondern durchgehende Erzählungen. So unerquicklich es sein mag, alle vier Evangelien am Stück zu lesen – jedes einzelne für sich ist einer fortlaufenden Lektüre durchaus zu empfehlen, weil nur so der individuelle Charakter des Blicks auf die Jesusgeschichte und der charakteristische Spannungsbogen, den jedes Evangelium hat, zu spüren sind. Dabei steht allerdings das Lukasevangelium auch noch mit der Apostelgeschichte in enger Beziehung, die vermutlich von demselben Autor stammt und mit ihrem Anfang an das Lukasevangelium anknüpft. Um aber dieses lukanische Doppelwerk einmal am Stück zu lesen, muss man das Johannesevangelium überspringen. Solches Springen in der Bibel ist auch notwendig, wenn man den Beziehungen folgt, die zwischen dem Johannesevangelium und den drei Johannesbriefen bestehen. Da macht es keinen Sinn, brav all das zu lesen, was nach dem Johannesevangelium kommt, bevor ich dann endlich zu den Johannesbriefen komme.
Die Bibel ist von ihrer Struktur her also kein einheitlicher Text, der stur von vorne nach hinten gelesen werden soll, sondern eher etwas für Leute, die z.B. auch gerne im Internet surfen. Dort gibt es nicht nur Texte, die ich fortlaufend lesen soll, so wie sie nacheinander kommen, sondern auch Links, die einen temporär wegführen vom gerade gelesenen Text. Da öffnen sich Fenster, die Hintergrundinformationen geben oder neue Sinndimensionen eröffnen, da gibt es Links, die mich zum ursprünglichen Text zurückführen usw. Ähnlich ist es auch in der Bibel: Wenn wir aufmerksam lesen, begegnen wir einer Fülle von Vorverweisen, Rückbezügen und Querverweisen. Manches gehört eng zusammen, obwohl es weit auseinandersteht, bestimmte Teile laden zum kontinuierlichen Lesen ein, andere haben eine eher lockere Struktur. Wer so etwas als Mangel empfindet, sollte sich nicht an die Bibel wagen.
Das vielschichtige, dezentral organisierte Textgewebe der Bibel verlangt Leserinnen und Leser, die einerseits sensibel genug sind, auf das zu achten, was der Text an Struktur anbietet, die aber andererseits auch selbstständig genug sind, im Text zu surfen, um sich fehlende Informationen zu holen oder ihr Verständnis zu vertiefen. Diese Spannung zwischen Hingabe an den Text und eigenwilligem Manövrieren kennzeichnet vermutlich jeden Umgang mit Literatur, aber bei der Bibel ist diese Spannung auch noch in der Struktur des Textes verankert.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was der biblische Kanon für ein Gebilde ist, muss man sich klarmachen, dass es weder im Frühjudentum noch in der frühen Kirche eine zentrale Autorität – wie Synode oder Papst – gab, die hätte entscheiden können, welche Texte zur Bibel zu rechnen sind. Es waren vielmehr bestimmte Gewohnheiten, die sich allmählich durchsetzten, weil sie offensichtlich eine gewisse Plausibilität hatten – zumindest für die Gruppen und Kreise, die für die Traditionspflege wichtig waren. Für das Lesen wäre es natürlich wichtig, die Leitidee zu kennen, die darüber entschied, ob ein Text akzeptiert und aufgenommen wurde oder nicht. Was die Bildung des Neuen Testaments angeht, so gab es sicher verschiedene Kriterien. Eines war die Überzeugung von der Einheit Gottes, der die Welt im Prinzip gut geschaffen hat. Deswegen wurden Texte aussortiert, die einen bösen Schöpfergott von einem guten Erlösergott unterschieden. Eine andere Leitidee war die Realität der Menschwerdung. Texte, die irgendwie nahelegten, dass eine göttliche Person in Jesus nur scheinbar oder vorübergehend als Mensch erschien, wurden abgelehnt. Daneben spielten aber sicher auch Autoritätsmomente eine Rolle. Das heißt, es wurden Texte aufgenommen, weil man sie einem bestimmten Autor zuordnete. Das bedeutet, dass es durchaus sein könnte, dass man die Pastoralbriefe nicht aufgenommen hätte, wenn man gewusst hätte, dass sie nicht wirklich von Paulus sind. Auch der (religiös ziemlich inhaltsarme) Dritte Johannesbrief dürfte seinen Platz im Neuen Testament der Tatsache verdanken, dass man seinen Verfasser mit dem vierten Evangelisten und diesen mit dem Apostel Johannes (Sohn des Zebedäus) identifizierte.
Die eigenartige, historisch gewachsene Struktur stellt für die Lesenden eine große Herausforderung dar, die einer Bergwanderung nicht unähnlich ist. Zwar hängen die Berge alle irgendwie mit den anderen zusammen, aber die Wege von einem Gipfel zum anderen sind selten gerade, meistens verschlungen. Oft gibt es mehrere Möglichkeiten, aber deswegen ist doch nicht jeder Weg möglich. Wer im Gebirge den Absturz vermeiden will, muss genau auf das Gelände achten und immer bereit sein, dazuzulernen. Das gilt übertragen auch für das Bibellesen. Wer da den Absturz in das Missverständnis (oder gar den Unsinn) vermeiden will, muss ebenfalls darauf achten, welche Wege möglich sind. Natürlich kann ich theoretisch alles mit den Texten machen und alles mit allem kombinieren. Der Text kann sich gegen keine Vergewaltigung wehren, aber wenn ich hören und verstehen will, dann muss ich darauf achten, welche Wege zwischen den Texten gangbar sind. Wenn ich den Text als Kommunikationspartner respektiere, dann frage ich also, welche Beziehungen zwischen den biblischen Texten selbst angelegt sind. Das ist manchmal mühsam und verlangt viel Selbstdisziplin.
Schließlich sei noch angefügt, dass wir es bei den Texten der Bibel auch noch mit ganz unterschiedlichen Gattungen zu tun haben. Da gibt es Erzählungen, Gesetzessammlungen, Mythen, Gebete, Lieder, Sprichwörter, Gottesdienstordnungen, (echte und falsche) Briefe, Gleichnisse, Visionen usw. Und selbstverständlich will jede Gattung so gelesen werden, wie es ihr angemessen ist. Bei profaner Literatur ist uns das selbstverständlich. Kaum jemand wird ein Theaterstück wie einen Gesetzestext lesen oder eine Gebrauchsanweisung wie ein Liebesgedicht. Wenn wir es trotzdem tun, dann kann kein Text uns daran hindern, aber wir sollten wenigstens wissen, was wir tun und warum unser Leseergebnis sich sehr unterscheidet von dem, was andere entdecken. Bei der Bibel dagegen ist vielen eine solche Sensibilität für die Gattung des Textes ziemlich fremd. Da ist es – um im Bild zu bleiben – durchaus üblich, das Liebesgedicht wie ein Kochrezept zu lesen und den Samstagskrimi wie die Tagesschau. Das muss schiefgehen!
Die Bibel ist also aufs Ganze gesehen ein hochkomplexes Gebilde, das eher einem Wurzelgeflecht gleicht. Die Bibel ist keine leichte Lektüre. Sie verlangt eine hohe Kompetenz der Lesenden. Enttäuschung garantiert sie allen, die erwarten, dass ein freundlicher Erzähler – allwissend und zuverlässig – sie am Anfang an die Hand nimmt, sie auf geradem Wege durch den Text begleitet und sie am Ende unbeschadet wieder entlässt.
Читать дальше