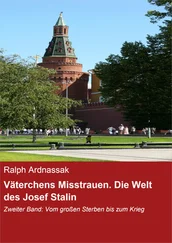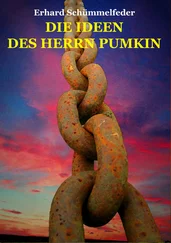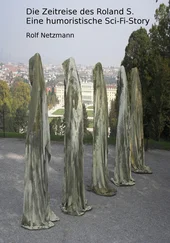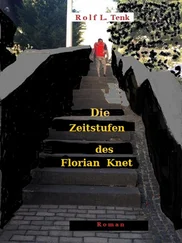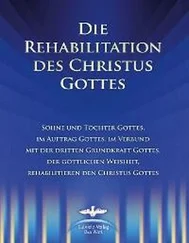103 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 74 f.
104 Vgl. F. Kaulen, a. a. O., 1729, F. Reusch, a. a. O., 141.
105 Erscheinungsort ist Mainz (Kurztitel: Sendschreiben).
106 J. B. Hirscher, Die kirchlichen Zustände der Gegenwart, Freiburg 1849.
107 Vgl. dazu die Ausarbeitungen dieser Arbeit in der Darstellung der Ekklesiologie Dieringers.
108 Erneut ist Mainz der Erscheinungsort (Kurztitel: Erörterungen).
109 Erschienen in Salzburg 1852.
110 Vgl. Erörterungen, Vorrede sowie 7 f.
111 „Ohne die öffentliche Herausforderung wäre ich schwerlich je dazu gelangt, mit den Güntherianern handgemein zu werden: ich gebe mich gar zu gerne dem guten Glauben hin, daß man mit der Zeit bei ruhiger Ueberlegung in die Schranken der Mäßigung zurückkehren werde.“, Erörterungen, Vorrede.
112 So F. Kaulen, a. a. O., 1729. Auch Günther selbst stellte Dieringers Angriffe gegen ihn in den Zusammenhang der Hermes-Debatte; vgl. P. Knoodt, Anton Günther. Eine Biographie (2. Bde.), Wien 1881 (Nachdruck Frankfurt 1981), 47. Kaulen sieht in Dieringers Reaktion eine „gewisse Reizbarkeit“ auftreten, die er auf dessen Gesundheitszustand zurückführt. Tatsächlich war der Ton neu, mit dem Dieringer schrieb und es war, wie er selbst schrieb, bisher nicht seine Art gewesen, auf Anfeindungen direkt zu reagieren.
113 Vgl. Erörterungen, Vorrede.
114 Vgl. E. Gatz., a. a. O., 76. Hermes war 1835 durch den Papst verurteilt worden. In der Bonner Universität vertrat u.a. der Priester und Professor für Philosophie P. Knoodt dessen Lehren; vgl. A. Franzen, a. a. O., 47.
115 Die in einem Briefwechsel mit P. Knoodt von einem Kollegen formulierte Einschätzung des Einfluss Dieringers auf Geissel zeigt die Stellung Dieringers im damaligen Erzbistum Köln: „Überdies gilt er bei dem Coadjutor-Erzbischof Geissel Alles: ist jener gegen Dich, so ist dieser nicht mehr für Dich zu gewinnen.“, P. Knoodt, a. a. O., 340.
116 Vgl. F. Kaulen, a. a. O., 1727.
117 Die abweichenden Jahreszahlen von 1855 und 1856 für die Benennung Dieringers als Bischofskandidat für Paderborn sind darauf zurückzuführen, dass der Bischofsstuhl von Paderborn schon 1855 vakant wurde, das Domkapitel aber erst im Januar 1856 den Nachfolger wählt, der dann im August 1856 sein Amt antritt. Vgl. dazu die Unterschiede in den Angaben der genannten Quellen in Fußnote 118.
118 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 77, A. Franzen, a. a. O., 48, F. Kaulen, a. a. O., 1729., F. Reusch, a. a. O., 141, J. Wetzel, a. a. O., 203.
119 Vgl. K. Hengst, Martin, in: NDB, 291 f. Martin, der 1844 nach Bonn kommt, dort Moral- und Pastoraltheologie liest, übernimmt von Dieringer dessen provisorisches Amt als Konviktsleiter. Gemeinsam mit Dieringer wird Martin zum Universitätsprediger ernannt. Er genießt ebenfalls die Unterstützung Geissels. Die Zusammenarbeit mit Dieringer wird als harmonisch ihre Beziehung zu einander als freundschaftlich bezeichnet; vgl. E. Gatz, a. a. O., 70 f. Martin gehört als Bischof zu den Verteidigern und Befürwortern der Dogmatisierung der Unfehlbarkeit des Papstes. Neben Dieringer war Martin weniger exponiert, ist aber in der Folgezeit als engagierter Vertreter ultramontaner und strengkirchlicher Positionen aufgetreten und hat die Jesuiten und die Neu-Scholastik gefördert. Persönlich mag es Dieringer durchaus getroffen haben, dass der junge Kollege statt seiner ins Bischofsamt berufen wurde, da Martin über kaum akademische Qualifikation verfügte und sein einziges theologisches Werk, das „Lehrbuch der katholischen Moral“ von 1850, in weiten Teilen ein Plagiat war, wie Schrörs nachweist; vgl. H. Schrörs, a. a. O., 465.
120 F. Reusch, a. a. O., 141.
121 E. Gatz, a. a. O., 76, und A. Franzen, a. a. O., 48, gehen davon aus, dass Dieringer insbesondere die Kapitel des Provinzialkonzils zu Güntherianismus und Hermesianismus geschrieben hat.
122 Mainz 1863 (Kurztitel: Epistelbuch).
123 Vgl. Epistelbuch, Vorrede, V.
124 Vgl. Epistelbuch, V-VI.
125 Vgl. Epistelbuch, VIII.
126 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 48, E. Gatz a. a. O., 77, F. Kaulen, a. a. O., 1730, F. Reusch, a. a. O., 141, J. Wetzel, a. a. O., 203.
127 Vgl. J. Wetzel, a. a. O., 210.
128 Dieringers Trauerrede auf Geissel wurde bereits erwähnt; sie spiegelt dieses Verhältnis wider.
129 Vgl. die Auflistungen bei E. Gatz, a. a. O., 71, und A. Franzen, a. a. O., 46.
130 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 77.
131 Kurztitel: Laienkatechismus.
132 Vgl. F. Kaulen, a. a. O., 1730.
133 Vgl. Laienkatechismus, Vorrede, V und VII. Gewidmet ist dieses letzte theologisch-wissenschaftliche Werk Dieringers dem Bischof von Speyer, Nikolaus Weiss. Dieringer war dessen Nachfolger als Leiter des Katholik und dessen Dozent am Priesterseminar.
134 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 76.
135 Vgl. E. Hegel, Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 5, Köln 1987, 72-80; Melchers ist allerdings ein Kandidat, den die Mehrheit des Kapitels - darunter auch Dieringer -, Papst und König vorgeschlagen hatte; vgl. ebd. Es muss hier auch darauf hingewiesen werden, dass diese Verhaltensweise der Preußischen Regierung zwischen 1819 und 1929 der Normalfall waren. In dieser Zeit bis zum Anschluss des Preußenkonkordats findet keine Bischofswahl frei durch ein Kapitel statt. Das sogenannte irische Listenverfahren, was auch im Fall der Nachfolge Geissels zur Anwendung kam, machte die meisten Wahlen zu einer Farce; vgl. dazu E. Gatz, Domkapitel und Bischofswahlen in Preußen 1821 – 1945, in: RQ 78 (1983), 101-126, bes. 108.
136 Vgl. Theol. Literaturblatt 1868, Nr. 6 bis 9, 23,24. Im Nachfolgenden wird die Zeitschrift TL abgekürzt.
137 Näherin bespricht Dieringer den ersten Band der 2. Auflage.
138 Die Theologie der Vor- und Jetztzeit. Ein Beitrag zur Verständigung, Bonn 1868; 2. Auflage, Bonn 1869 (Kurztitel: Vorzeit).
139 Vgl. dazu Vorzeit, VII.
140 Vgl. Vorzeit, V.
141 Vgl. dazu E. Hegel, a. a. O., 212, sowie E. Gatz, a. a. O. (1975), 77; aber auch Dogmatik, 17, 20 ff. sowie 595.
142 Vgl. E. Gatz, a. a. O. (1975), 79, F. Reusch, a. a. O., 141 sowie F. Kaulen, a. a. O., 1730. Nachdem zunächst aus Deutschland nur Alt-Germaniker und damit Vertreter der Neu-Scholastik der Würzburger Schule berufen worden waren, kam es zu Protest verschiedener Bischöfe und Kardinäle. Nun wurden seitens der Nuntiatur in München u.a. Hefele und Dieringer als mögliche nach zu berufende Mitglieder der Vorbereitungskommission aus der deutschen Professorenschaft vorgeschlagen. In den Stellungnahmen des Nuntius zu Dieringer nimmt dieser ihn von seiner ansonsten pauschalen Kritik an der deutschen Professorenschaft aus und bewertet einzig dessen Schrift gegen Kleutgen als kritisch. Aus römischer Sicht gehört Dieringer nicht zur römischen aber auch nicht zur deutschen Schule; er war somit durchaus ein Kandidat für die Vorbereitungskommission, der von beiden Seiten akzeptiert worden wäre. Vgl. dazu R. Lill, Die deutschen Theologieprofessoren vor dem Vatikanum I im Urteil des Münchner Nuntius, in: E. Iserloh / K. Repgen (HG.), Reformata Reformanda, 1965, 483-509; bes. 492-96, 499, 506.
143 Die überzeugendste Übersicht über Dieringers Verhalten bietet E. Hegel, a. a. O., 538-543. Diese ist frei von Mutmaßungen und Wertungen.
144 Vgl. E. Hegel, a. a. O., 538 f.
145 Vgl. Dogmatik, 560 f.
146 Diese Vorgehensweise hatten die Oppositionellen eigentlich insgesamt angestrebt; vgl. dazu auch A. Franzen, a. a. O., 50.
147 J. Wetzel, a. a. O., 206, spricht von einem rücksichtsvollen Umgang mit ihm.
148 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 54 und W. Spael, a. a. O., 124.
149 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 54, E. Gatz, a. a. O. (1975), 83.
150 Von seiner Präsidentschaft im Borromäusverein tritt er ebenfalls zurück, bleibt aber bis zu seinem Tode im Vorstand des Vereins, vgl. W. Spael, a. a. O., 124. Den Titel eines Geistlichen Rats führt Dieringer auch in Hohenzollern; vgl. K.-H. Braun, a. a. O., 322.
Читать дальше