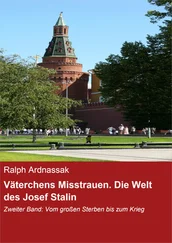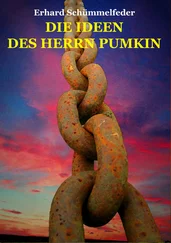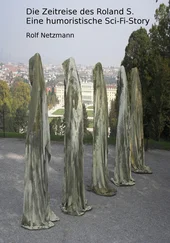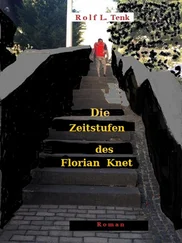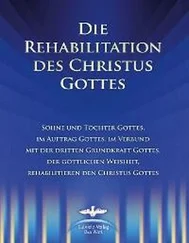33 Vgl. W. Reinhard, Die Anfänge des Priesterseminars und des theologischen Konvikts in der Erzdiözese Freiburg i Br., in: FDA 56 (1928), 192.
34 Vgl. dazu auch das Kapitel zu Wessenberg dieser Arbeit sowie die Hinweise von Reinhard, a. a. O.
35 Mehrere Autoren (Wetzel, Reinhard, Franzen) sprechen hier davon, dass Dieringer ging, um in Baden „nicht weiter zu stören“; vgl. A. Franzen a. a. O., 41.
36 Gatz, a. a. O., 64, zitiert aus einem Brief Geissels vom 18. Juli 1840, der Dieringer um sein Kommen nach Speyer bittet.
37 So auch F. Reusch, Dieringer, in: ADB, 141.
38 Vgl. R. Koch, a. a. O., 132 sowie E. Gatz, a. a. O., 64, F. Lauchert, Dieringer, in: Kirchliches Handlexikon I, 1116, ders., Dieringer, in: LThK 1III, 314.
39 Vgl. Kaulen, Dieringer, in: KL, 1728 sowie Reusch, Dieringer, in: ADB, 141.
40 „Seit fast einem Vierteljahrhundert habe ich zu dem hohen Verblichenen nicht bloß in amtlichen, sondern in persönlichen, ich darf wohl sagen freundschaftlichen Beziehungen gestanden“; Dieringer, „Trauerrede auf S. Em. den hochwürdigsten Herrn Johannes Cardinal von Geissel“, Köln 1864, 3. Die Tatsache an sich schon, dass Dieringer die Trauerrede auf Geissel hielt, spricht von der innigen Verbundenheit der beiden Geistlichen. Kaulen spricht ähnlich aber zurückhaltender von Geissel als „sein Bischof, zu dem er in ein näheres Verhältnis getreten war“, a. a. O., 1728.
41 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 64, F. Kaulen, a. a. O., 1728, sowie Dieringers „Trauerrede auf S. Em. Den hochwürdigsten Herrn Johannes Cardinal von Geissel“, Köln 1864 (im Folgenden Trauerrede abgekürzt), die von hoher Wertschätzung für Geissels Person und Lebenswerk geprägt ist und zudem mehrfach die Freunde an seiner Seite erwähnt, die ihn begleiteten, vgl. ebd., 4 und 9. Dieringer stellt dabei die Trauerrede unter das Bibelwort „Er ward geliebt von Gott und den Menschen; sein Andenken ist im Segen. (Sir 44,1)“. Die Stelle selbst bezieht sich auf den Erzvater Moses und findet hier durch Dieringer Anwendung auf Geissel; vgl. Trauerrede, 3. Dieselbe Stelle hatte Dieringer auch bereits auf den Heiligen Karl Borromäus angewandt, der nach Dieringer ein „erleuchteter Bischof“ und „ein eifriger Kirchenverbesserer“ war; vgl. Dieringer, Der heilige Karl Borromäus und die Kirchenverbesserung seiner Zeit, Köln 1846 (nachfolgend Borromäus abgekürzt), 48 sowie bezüglich des Bibelzitats 379. Wetzel, a. a. O., 210, zitiert W. Spael, der in seinem Buch „Das Buch im Geisteskampf. 100 Jahre Borromäusverein“, Bonn 1950, berichtet, dass Geissel sooft er in Bonn war, bei Dieringer wohnte.
42 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 65.
43 So E. Gatz, ebd., und Dieringer, Trauerrede, 4.
44 Vgl. R. Pesch, a. a. O., 140 ff.
45 Der andere Mitbegründer der Zeitschrift, Nikolaus Räss, wird im selben Jahr zum Bischof von Straßburg ernannt. Vgl. A. Franzen, a. a. O., 42.
46 A. Franzen, ebd. Auch R. Pesch, a. a. O., 141, beschreibt den Katholik als „maßgebend“ und prägend für alle weiteren nachfolgenden Kirchenblätter.
47 Vgl. R. Pesch, a. a. O., 141, A. Franzen, a. a. O., 42, E. Gatz, a. a. O. 64.
48 R. Pesch bescheinigt dem Katholik eine hohe journalistische Qualität, jedoch auch eine „populäre Apologetik“ bis hin zum „theologischen Dilettantismus“; vgl. ders., a. a. O., 142 f.
49 Vgl. Pesch, a. a. O., 141.
50 Es sei an dieser Stelle bereits darauf verwiesen, dass Dieringer auch in Bonn eine eigene Zeitschrift gründen wird. Bezeichnend ist auch, dass sich unter den 6 Hauptwerken Dieringers nur 2 dogmatischsystematische Werke für einen theologischen Fachleserkreis finden, nämlich seine Dogmatik und das erwähnte „System der göttlichen Thaten“ (Polemik und Dialectik), die anderen Schriften sind praktisch-theologisch geprägt und für breite Leserkreise konzipiert.
51 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 66 f.
52 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 42, Wetzel, a. a. O., 201.
53 Franzen berichtet, dass auch Staudenmaier, Hefele und Kuhn angefragt wurden; Geissel suchte somit gezielt nach Vertretern der Tübinger Schule bzw. nach Vertretern der positiven Theologie; ders., a. a. O., 43, ähnlich auch F. Kaulen, a. a. O., 1728. Ähnlich auch H. Schrörs, Ein vergessener Führer aus der rheinischen Geistesgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, Johann Wilhelm Joseph Braun (1801-1863), Bonn/Leipzig 1925, 464 f.
54 Vgl. H. Schrörs, a. a. O., 464, der die entsprechende Korrespondenz und die Universitätsakten eingesehen hat.
55 Vgl. R. Koch, a. a. O., 132, E. Gatz, a. a. O., 66 f., A. Franzen, a. a. O., 43 und F. Reusch, a. a. O., 141. Die Nekrologie, FDA 17 (1885), 103, nennt falsch 1844 als Jahr der Berufung nach Bonn.
56 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 46. Auch H. Schrörs, a. a. O., 423, erwähnt „heftige Angriffe auf das Wirken und die Person des Professors Dieringer in Bonn“ in der Presse, obschon Dieringer „nicht einmal direkt gegen die Hermesianer aufgetreten war“. Es scheint, dass hier Dieringer stellvertretend für Geissel bzw. als Mann Geissels angegriffen wird, dessen entschieden anti-hermesianisches Vorgehen gerade auch im Kölner Diözesanklerus zu Anfeindungen führte; vgl. dazu auch H. Schrörs, a. a. O., 374 f.
57 So zitiert Franzen einen Zeitzeugen aus dem Kreis der Seminaristen; vgl. Ders., a. a. O., 46. Dieringer geht also hier ähnlich vor wie auch bei der journalistischen Ausrichtung der KZWK.
58 H. Schrörs, a. a. O., 466, weist nach, dass Dieringer der Berufung Martins aufgrund dessen zu geringer fachlicher Qualifikation eher ablehnend gegenüber stand; tatsächlich trägt Martin in der Folge wenig zum Aufschwung der Fakultät bei.
59 Vgl. F. Kaulen, a. a. O., 1728, A. Franzen, a. a. O., 43.
60 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 66-68, A. Franzen, a. a. O., 43 f.
61 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 44 sowie E. Gatz, a. a. O., 68-69. Diese Einschätzung teilt auch E. Hegel in seiner kurzen Beschreibung der Zeit Dieringers an der Bonner Fakultät; vgl. E. Hegel, Geschichte des Erzbistums Köln, Köln 1987 (Bd. 5), 211-214. Schrörs geht in seiner Biographie Brauns davon aus, dass der Hermesianismus „i. J. 1842 auch in Bonn so gut wie tot“ war und die Professoren Achterfeldt und Braun sie allein schon aufgrund ihrer Lehrfächer Moral-, Pastoraltheologie und Kirchengeschichte wohl kaum hätten aufrechterhalten können; vgl. dazu H. Schrörs, Johann Wilhelm Joseph Braun (1801-1863). Ein vergessener Führer aus der rheinischen Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bonn/Leipzig 1925, 374. Schrörs bietet auf den Seiten 423-425 eine kurze Abhandlung über das Ende der hermesianischen Schule und die Gründe für dieses.
62 Kaulen, a. a. O., 1728. Franz Philipp Kaulen (1827-1907) studierte von 1846 bis 1849 katholische Theologie in Bonn und wurde 1880 Professor für praktische Theologie, 1882 für alttestamentliche Exegese in Bonn. Er war ein Student Dieringers. Vgl. Gatz, Kaulen, in: NDB, 357 f. Auch W. Spael, Das Buch im Geisteskampf. 100 Jahre Borromäusverein, Bonn 1950, 23, spricht von Schwung und Vitalität Dieringers bei Beginn seiner Zeit in Bonn.
63 Vgl. Gatz, a. a. O., 66.
64 Franzen erwähnt einen Briefwechsel zwischen Bischof Arnoldi und Erzbischof Geissel über eine Vortragsreise Dieringers nach Trier, in dem Arnoldi sich tief beeindruckt zeigt von der rhetorischen Wirkung Dieringers auf seine Geistlichkeit; vgl. Franzen, a. a. O., 45.
65 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 43.
66 A. Franzen, a. a. O., 43, erwähnt, dass Staudenmaier, Hefele und Kuhn angefragt wurden, aber aus je anderen Gründen nicht nach Bonn wechselten. Zurecht interpretiert er diese Auswahl als eine bewusste Entscheidung des Erzbischofs Geissel für die Vertreter der positiven Theologie bzw. der Tübinger Schule. So auch H. Schrörs, a. a. O., 464-465, der ferner Mack und den Freiburger Regens Kössing nennt; ders., a. a. O., 465 weist nach, dass Hefele und Mack am Veto der Landesregierung scheiterten. Die Umgestaltung der Fakultät bleibt somit „eine Halbheit“, so Dieringer, zitiert nach H. Schrörs, a. a. O., 464.
Читать дальше