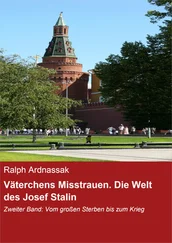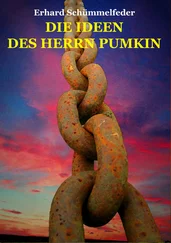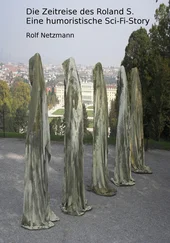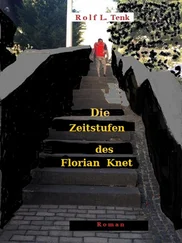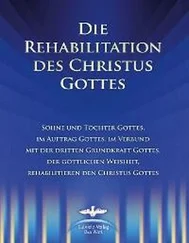67 Bis 1871 wird Dieringer sieben Mal zum Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät gewählt; vgl. A. Franzen, a. a. O., 46. „Dieser Schwabe ist bis in die Zeit des Vatikanischen Konzils die tragende Säule der Fakultät gewesen.“, H. Schrörs, a. a. O., 464.
68 R. Pesch, a. a. O., 133, schreibt, dass Dieringer auch außerhalb des Rheinlands „als die rechte Hand Geissels galt“. H. Schrörs, a. a. O., 464, spricht von unbedingtem Vertrauen und Freundschaft, die beide miteinander verbannt.
69 R. Pesch, a. a. O., 131, nennt Hilgers, Martin, Scholz und Vogelsang als Mitarbeiter aus der Katholisch-Theologischen Fakultät.
70 Im Folgenden KZWK Jahrgang/Band (Erscheinungsjahr) abgekürzt.
71 Der Titel lautet dann entsprechend „Katholische Vierteljahrsschrift für Wissenschaft und Kunst“ (KVWK).
72 Kaulen nennt 1843 als Gründungsjahr der KZWK; erstes Erscheinungsjahr ist aber erst 1844. Die bei E. Gatz, a. a. O., 72, genannte Jahreszahl 1848 für die Herausgabe der KZWK ist offensichtlich ein Tippfehler.
73 Diese Zeitschrift war 1832 gegründet worden und stellt 1852 ihr Erscheinen ein. Vgl. E. Gatz a. a. O., 72.
74 So schreiben A. Franzen, a. a. O., 47, E. Gatz, a. a. O., 72, F. Kaulen, a. a. O., 1728 sowie R. Pesch a. a. O., 133; allerdings ist Vogelsang, der ebenfalls als hermesianisch geprägt gilt, Mitherausgeber, was aber auch Zeichen seiner nachdrücklichen Läuterung sein kann. Pesch stellt jedoch ebenso heraus, dass alle Kirchenblattgründungen des Rheinlands, die mehrheitliche erst nach 1837 infolge des Kölner Ereignisse entstehen, einen anti-hermesianische Ausrichtung vorweisen; vgl. R. Pesch, a. a. O., 13 f. Ebd., 220 findet sich eine Zusammenstellung aller Mitarbeiter der KZWK.
75 Vgl. KZWK 1. Jh. / 1. Bd. (1844), 11. Zur Spannbreite der Themen vgl. R. Pesch, a. a. O., 135. Dort wird auch gezeigt, dass die Zeitung schließlich in den Blick der preußischen Zensur geriet (134) und schließlich als Vierteljahrsschrift verstärkt den Charakter einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift annimmt (138).
76 Pesch stellt dies in seinem Überblick zur Richtung und Tätigkeit der KZWK sehr gut dar. Dieringers Grundsatzartikel „Die katholisch-theologische Journalistik in Deutschland und ihre Aufgabe“ im Katholik 23. Jh. / 1. Heft (1843), 1-17 kann nach Pesch ebenso die Grundlage für die Arbeit der KZWK sein; vgl. Ders., a. a. O., 131-135.
77 Vgl. R. Pesch, a. a. O., 133.
78 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 73.
79 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 73, F. Kaulen, a. a. O., 1729. Zur Rolle Dieringers bei der Gründung des Borromäusvereins vgl. W. Spael, a.a., 27; Gründungsmitglieder sind u. a. auch der Kölner Weihbischof und Generalvikar Johann Baudri, der Bonner Professoren-Kollege und spätere Paderborner Bischof Konrad Martin sowie der Aachener Arzt und Gründer des Franziskus-Xaverius-Missionsvereins (heute: Internationales Katholisches Missionswerkes missio e. V.), Dr. Heinrich Hahn.
80 Vgl. Katholik 23. Jh. / 1. Heft (1843) Bd. 87, 5.
81 Vgl. KZWK 1. Jh. / 1. Bd. (1844), 4 f.
82 Köln, 1846 (Kurztitel: Borromäus).
83 Borromäus, III.
84 Borromäus, IV. Dieringer bringt den Verein in seiner Präsidentschaft auf insgesamt mehr als 54 000 Mitglieder und über 1400 Bibliotheken; vgl. E. Gatz, a. a. O., 73.
85 In der Rezension des Buches durch Repetent Fritz in der ThQ 29 (1847),540-548, findet u.a. die Darstellung des Trienter Konzils durch Dieringer lobende Erwähnung, vgl. 546. Nach Fritz ist das Werk Dieringers nicht nur eine wichtige Fortschreibung der Geschichte des Heiligen Karl Borromäus, sondern darüber hinaus eins Schrift, in der sich der Leser „über viele Fragen der Gegenwart gehörig orientieren“ kann (548).
86 Vgl. dazu F. Kaulen, a. a. O., 1729, E. Gatz, a. a. O., 74, J. Wetzel, a. a. O., 200, A. Franzen, a. a. O., 44, der sogar eine Petition Bonner Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen aus dem Jahr 1845 kennt, die von Dieringer eine Vorlesung über Geschichte und Dekrete des Trienter Konzils erbitten.
87 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 74.
88 Vgl. dazu auch Dieringer, Kanzelvorträge an gebildete Katholiken auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres (Kurztitel: Kanzelvorträge), 2 Bd., Mainz 1844, V-VI.
89 Vgl. E. Gatz, a. a. O., 70, F. Kaulen, a. a. O., 1728 f. F. Reusch, a. a. O., 141, nennt 1861 als Jahr, in dem Dieringer das Amt des Universitätspredigers aufgibt. E. Gatz, a. a. O., nennt 1862, R. Koch, a. a. O., 132, und J. Wetzel, a. a. O., 202, nennen ebenfalls 1861. Da Reusch zum strittigen Zeitpunkt bereits selbst Mitglied der Katholisch-Theologischen Fakultät war, erscheint seine Angabe zuverlässig.
90 Die zunächst auf drei Jahre befristete Einrichtung des Seminars wird 1848 dauerhaft eingerichtet; vgl. A. Franzen, a. a. O., 45, E. Gatz, a. a. O., 70.
91 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 44 f.
92 Mainz 1844 (Kurztitel: Kanzelvorträge).
93 Vgl. Kanzelvorträge, VI-VII. Heutige Pastoraltheologen würden dies eine zielgruppenorientierte, christozentrische Interpretation des Sonntagsevangeliums nennen.
94 Kanzelvorträge, VIII.
95 Kanzelvorträge, VIII.
96 1. Auflage 1847, 2. Auflg. 1850, 3. Auflage 1855 (Exemplare nicht mehr verfügbar), 4. Auflg. 1858, 5. Auflg. 1865; Erscheinungsort ist jeweils Mainz. Den dem Vf. vorliegenden Exemplaren ist zu entnehmen, dass Dieringers Dogmatik, sicher noch bis ins späte 19. Jahrhundert, wahrscheinlich aber auch noch im frühen 20. Jahrhundert als dogmatisches Lehrbuch in der Priesterausbildung verwandt wurde. In jüngster Zeit geht auch P. Görg in seinem mariologischen Kompendium, „Sagt an, wer ist doch diese“. Inhalt, Rang und Entwicklung der Mariologie in dogmatischen Lehrbüchern und Publikationen deutschsprachiger Dogmatiker des 19. und 20. Jahrhunderts, Bonn 2007, von einem weiten Bekanntheitsgrad der Dogmatik Dieringers im deutschsprachigen Raum aus. Vgl., ders., ebd., 379.
97 Vgl. Dieringer, Lehrbuch der katholischen Dogmatik, Mainz 1847 (Kurztitel: Dogmatik), IV. So interpretiert es auch J. Drey in seiner Rezension der Dogmatik als „ein Lehrbuch als Grundlage für seine Vorlesungen“; vgl. Drey, Rez. Dieringer, Dogmatik, in: ThQ 30 (1848), 303. Dreys durchweg positive Rezension der Dogmatik ist nach wie vor eine höchst gelungene zusammenfassende Darstellung von Inhalt und Gliederung des Werkes. - Im weiteren Verlauf der Arbeit wird in der Regel auf die erste Auflage der Dogmatik zurückgegriffen, die durch die Auflagen hindurch nur wenige inhaltliche Änderungen erfuhr. Der Verweis auf Abänderungen in anderen Auflagen wird jeweils erwähnt.
98 Dogmatik, V.
99 Vgl. Dogmatik, V sowie die Abhandlung dieser Arbeit zur theologischen Methodik Dieringers.
100 Vgl. A. Franzen, a. a. O., 46. Mit Dieringer wird auch seinem Tübinger Lehrer Drey dieselbe Würde zuteil. Wie Lauchert in seiner Biographie Staudenmaiers nachweist, erhalten damals wohl insgesamt 13 Personen den Ehrendoktortitel der Universität Prag; vgl. F. Lauchert, Franz Anton Staudenmaier (1800-1856), Freiburg 1901, 332, Anm.1).
101 Vgl. F. Kaulen, a. a. O., 1729, E. Gatz, a. a. O., 75, A. Franzen, a. a. O., 47, R. Koch, a. a. O., 132, sowie F. Reusch, a. a. O., 141.
102 Am 20. Juni 1848 hält er dort seine einzige Rede, die sich mit der Kirchenfreiheit befasst. Im November 1848 tritt er sein Mandat nach den Verhandlungen der im engeren Sinne kirchlichen Themen an Michael Frings ab; als Mitglied des Casino war er zudem Vertreter ein konstitutionellen Monarchie mit Erbkaisertum, in der die Nationalversammlung das Organ zur Begründung von Einheit und Freiheit in Deutschland darstellt. Vgl. dazu R. Koch, a. a. O., 38. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass seitens der Bonner Fakultät neben Dieringer noch Braun im Parlament vertreten ist; offenkundig hatte der suspendierte Kollege und Hermesianer Braun noch genügend Unterstützung für ein Mandat; er vertrat die katholischen Professoren; vgl. dazu E. Gatz, 75.
Читать дальше