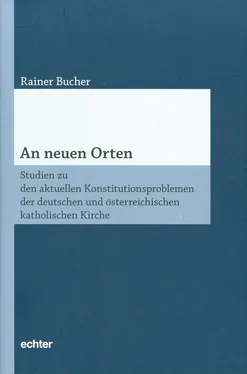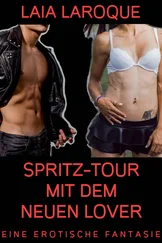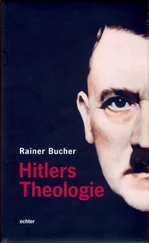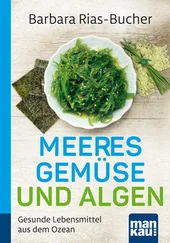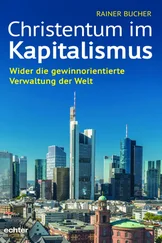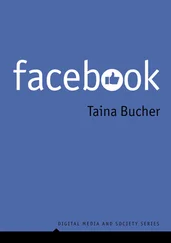Damit aber ist es nun vorbei, selbst bei Katholikinnen und Katholiken und selbst bei jenen, die grundsätzlich der Kirche noch etwas glauben und daher Kontakt zu ihr halten. Maria Widl hält ebenso lapidar wie zutreffend fest: „Seit Humanae vitae erweist sich die kirchliche Lehre über Ehe und Sexualität auch innerkirchlich als unvermittelbar“ und in die Kultur hinein wirke „sie nur insofern, als Menschen sich selbst als automatisch aus der Kirche ausgeschlossen betrachten, wenn sie sich scheiden lassen.“ 116
Der Synodentext arbeitet somit auf einer Grundlage, die nicht mehr existiert und selbst damals, sieben Jahre nach Humanae vitae , schon reichlich brüchig war. Er wirkt daher wie ein Relikt aus jüngst vergangenen Zeiten, als die private und intime Lebensführung sich zumindest grundsätzlich und in ihren Normen noch nach kirchlichen Vorgaben richtete. 117Vor allem für die kirchliche Zeitgeschichtsforschung erscheint somit der vorliegende Text interessant, nicht unbedingt für die notorisch gegenwartsorientierte Pastoraltheologie, der es um den situativen Sinn und die Bedeutung kirchlicher Traditionen heute geht. 118
Eine solche im eigentlichen Sinne pastorale Bedeutung scheint der Synodentext kaum mehr zu besitzen. Sinn und die Bedeutung dessen, worum es der katholischen Tradition im Bereich des engsten menschlichen Zusammenlebens geht, mag dem Text zu entnehmen sein, praktische Wirksamkeit entwickelt er selbst bei den Katholikinnen und Katholiken nicht mehr. Zudem dürfte er auch den kirchlichen Insidern schlicht mehr oder weniger unbekannt sein.
2 Analytische Annäherungen
Der pastoraltheologischen Kommentierung stehen in dieser Lage nun aber einige erprobte wissenschaftliche Auswege offen.
Zum einen kann auf eine gewisse pastorale Restrelevanz des kirchlichen Moraldiskurses hingewiesen werden. Diese Restrelevanz wird gerade durch die mittlerweile fast unüberbrückbar breite Zone zwischen offizieller kirchenamtlicher Normierung und heutiger Beziehungsrealität eröffnet – wenn auch meist im Modus des Konflikts. Austragungsorte solcher Konflikte sind dann zum Beispiel die professionellen pastoralen Akteure, etwa im jugendpastoralen Bereich. 119Sie sind angehalten, qua Dienstpflicht Positionen zu vertreten, die sie zum größten Teil selbst nicht für plausibel erachten, die sicherlich jedenfalls den wenigsten ihrer Adressaten noch plausibilisierbar sind.
Auch wirken in spezifischen kirchlichen Sozialmilieus, etwa in den Pfarrgemeinden, die kirchlichen Lehren zu Ehe und Familie durchaus noch wertungs- und milieuprägend nach. Gegen die kirchlichen Lebensführungsnormen (offen) verstoßende Gemeindemitglieder und Hauptamtliche im pastoralen Dienst müssen immer noch mit Ausgrenzungsreaktionen rechnen. Freilich sind auch Phänomene einer gewachsenen Toleranz gegenüber „abweichenden“ Lebenskonzepten im innerkatholischen Milieu zu beobachten, 120nicht zuletzt die fast schon selbstverständliche Akzeptanz quasi-ehelicher Lebensformen von Pfarrpriestern seitens der Gemeinde belegt dies. Diese sich anbahnende Offenheit könnte darin begründet sein, dass auch ältere Gemeindemitglieder spätestens in den Lebensformen ihrer eigenen Kinder und Enkel seit einiger Zeit mit den gewandelten Beziehungsrealitäten der Gegenwart konfrontiert sein dürften und entweder die Sinnlosigkeit moralisierenden Protests dagegen erkennen oder gar diese neue Beziehungspluralität als Fortschritt gegenüber der eigenen, „unfreieren“ Sozialisation erleben.
Nicht zu vergessen schließlich ist das persönliche Gewissen, das sicher für manche Katholikin, manchen Katholiken einen Ort darstellt, an dem der Spalt zwischen eigener Lebensweise und Lebensform und kirchenoffiziellen Normierungen zumindest erkennbar und relevant wird und wo daher die offizielle kirchliche Lehre bleibende, wenn auch relativierte Relevanz besitzt.
2.2 Die gesellschaftliche Entwicklung
Die pastoraltheologische Relektüre des Synodenbeschlusses kann zudem die Entwicklungen rekonstruieren, die zur beschriebenen Irrelevanz kirchenoffizieller Diskurse im Feld von „Ehe und Familie“ führten. Hier dürften zwei an sich zu unterscheidende, sich aber wechselseitig verstärkende und zuletzt in ihrer gemeinsamen Grammatik verwandte Prozesse zu jener geradezu diametralen Spreizung von kirchlicher Norm und realen Praktiken auch bei praktizierenden Kirchenmitgliedern im Feld von Ehe, Familie und Sexualpraktiken geführt haben, die heute zu beobachten ist.
Zum einen hat in den letzten Jahrzehnten ein grundlegender Umbau der Vergesellschaftungsformen des Religiösen in der deutschen Gesellschaft stattgefunden. Religiöse Partizipation und religiöse Praktiken organisieren sich dramatisch abnehmend in den Kategorien von exklusiver Mitgliedschaft, lebenslanger Gefolgschaft und umfassender religiöser Biografiemacht, wie sie für die katholische Kirche lange nicht nur normativ, sondern in hohem Maße auch real galten. Im Zuge der globalen Durchsetzung eines liberalen, kapitalistischen Gesellschaftssystems geraten religiöse Plausibilitäten und die ihnen folgenden moralischen Normen und Praktiken unter den Zustimmungsvorbehalt des Einzelnen. Je näher diese Plausibilitäten und Normen die persönliche Lebensführung berühren, umso mehr wird diese Freiheit auch beansprucht. 121Dies bedeutet nichts weniger als die Verflüssigung der Kirchen als ehemals mächtige Heilsbürokratien. 122
Der gleiche hintergründige Freisetzungsprozess hat auch zur Verflüssigung der früher mehr oder weniger ehernen Geschlechterrollen geführt. Es ist zwar erst seit kurzem, aber eben mittlerweile überaus wirksame gesellschaftliche Realität, dass Frauen gleichberechtigten Zugang zu Bildungsressourcen und damit zu Positionen mit eigenständigen Einkommens- und damit Selbsterhaltungschancen besitzen. 123Dies befreite Frauenbiografien von der früher praktisch unlösbaren (Ausnahme: Klostereintritt) Kopplung an Männerbiografien. Grundsätzlich entkoppelt wurden zudem mehr oder weniger zeitgleich Sexualität von Reproduktion sowie das patriarchale Schema, das Frauen der „Innenwelt“ von Gefühl, Haushalt und Religion, Männer aber der „Außenwelt“ von Öffentlichkeit, Herrschaft, Rationalität und Krieg zuwies.
Der daraus folgende irreversible Wandel der Familienformen ist Gegenstand intensiver soziologischer Forschung. 124Denn:
[Das] Ausmaß der Veränderungen ist verblüffend. An Stelle der fraglosen Realisierung der elterlich-traditionellen Lebensform ist deren Infragestellung getreten. Was bei den Eltern noch als kulturelle Selbstverständlichkeit galt, ist für die Kindergeneration zum Gegenstand von Aushandlungsprozessen zwischen den Partnern geworden. (…) Das Hochbemerkenswerteste dieses Wandels liegt in der Tatsache, daß er sich in einem Zeitabstand von nur einer familiaren Generation abgespielt hat. 125
Die Zahl der Eheschließungen pro Tausend Einwohner etwa nahm von 1950 bis 2009 um mehr als die Hälfte von 10,8 auf 4,6 ab. 126
Selbst auf einem Studientag der Deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2008 wurde vom familiensoziologischen Referenten den kirchlichen Amtsträgern deutlich gemacht, dass unter diesen Bedingungen eine „Re-Traditionalisierung von Ehe und Familie, damit eine unweigerliche Re-Traditionalisierung der Geschlechterverhältnisse … ausgeschlossen“ 127ist. Wobei die Geschichte belegt, dass etwa jenes vom kirchlichen Lehramt noch bis vor kurzem teilweise vehement vertretene Modell der „Hausfrauenehe“ 128selbst erst neueren Datums ist, insofern „die in den letzten Jahrzehnten gestiegene Erwerbstätigkeit von Müttern kein neuartiges Phänomen [ist], sondern … nur die Rückkehr der Frauen in früher innegehabte Positionen des Produktionsprozesses [bedeutet]“ 129. Erst für die bürgerliche Ehe ab dem 19. Jahrhundert war es charakteristisch, dass die Ehefrau keiner Erwerbsarbeit nachgehen musste. Neu freilich ist heute die tendenzielle, wenn auch immer noch zögerliche, politisch aber gewollte und unterstützte Auflösung geschlechtsspezifischer Berufswahl und Statuslagen.
Читать дальше