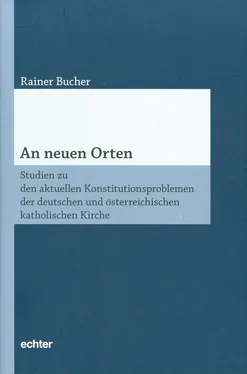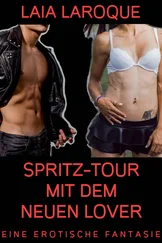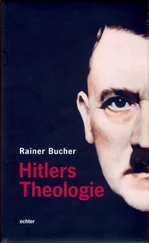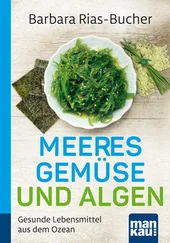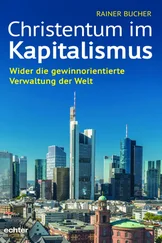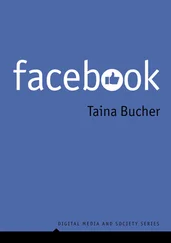Mit all dem aber ist es nun vorbei, keine dieser Balancen hält mehr, auch und gerade nicht in Österreich. Die Identifikation von Institution und Person im Religiösen hat sich praktisch völlig aufgelöst, ja wendet sich geradezu dramatisch gegen die Kirche. Die Identifikation des Heils mit dem Priestertum zerfließt im Anerkennungsdefizit eines Priestertums, das seinen Ort in einer nicht mehr klerikalistischen Sozialform von Kirche noch nicht wirklich gefunden hat und dessen geradezu verzweifelte Lage man an den Eintrittszahlen in die Seminarien wohl am direktesten ablesen kann.
Die Autorität zur Normierung und Steuerung des Verhältnisses von Orthodoxie und Orthopraxie, überhaupt von Lehre und Erfahrung, sie ist nun aber schon lange, hauptamtliche Mitarbeiter ausgenommen, den kirchlichen Institutionen aus den Händen geglitten. Die Individuen bestimmen selbst die für sie gültige Justierung dieses Verhältnisses.
Damit zerfließt die Monopolstellung des Katholizismus und damit auch dessen verhaltens- und wahrnehmungsprägende Kraft. Gerade in Österreich mit seiner jahrhundertealten Dominanz der katholischen Religion wird dies ebenso aufmerksam wie nervös wahrgenommen. Der Katholizismus als die politisch-gesellschaftliche Realisationsform der katholischen Kirche zerlegt sich gegenwärtig in Österreich in eine Reihe von Diadochenkonzepten.
Vier wird man versuchsweise identifizieren können. Das sind zum einen die Reste des alten volkskirchlichen und „kulturkatholischen“ Konzepts, da sind weiter „katholikale“ Gruppierungen, begünstigt und aufgewertet durch eine Serie von Bischofsernennungen zwischen 1985 und 1995 (Krenn, Groer, Eder, Laun et alii), da existiert ein geschwächtes, aber weiterhin virulentes progressives Milieu etwa um die „Wir sind Kirche“-Bewegung sowie, vom Wiener Kardinal Schönborn sehr gefördert, ein charismatisch inspiriertes Milieu mit deutlichen Nähen zu parallelen Bewegungen im Protestantismus.
All diese Milieus nehmen Welt und Wirklichkeit natürlich ganz unterschiedlich wahr. Das ist am unmittelbarsten daran ablesbar, wie sie mit den Komplexitätserfahrungen umgehen, welche die katholische Tradition nun einmal provoziert. Der entscheidende Unterschied zwischen all diesen Konzepten dürfte darin liegen, wie sie diese typisch katholische Komplexität reduzieren.
3 Reaktionen
3.1 Anhaltender „Kulturkatholizismus“
Österreich ist das Land mit einer jahrhundertelangen Verbindung von „Thron und Altar“. Die Habsburger garantierten die letztlich unumstrittene Vorherrschaft des Katholizismus, unterstützten die Gegenreformation, wenn es sein musste, wie in der Steiermark, auch gewaltsam. Das ist bis heute etwa im Stadtbild von Graz unmittelbar architektonisch wahrnehmbar, wo die „Stadtkrone“ mit herrschaftlicher Burg und bischöflichem Dom über der zeitweise protestantischen Bürgerstadt thront und das gegenreformatorische Priesterseminar wie das Hauptquartier einer Interventionstruppe demonstrativ sichtbar in den Hügel hinein gebaut wurde
Ein schönes Sinnbild des Bündnisses von „Thron und Altar“ ist der – ehemalige – direkte Verbindungsgang von Burg und Dom im 1. Stockwerk; dass er heute nicht mehr existiert, deutet freilich an, was auch ansonsten gilt: Die „katholische Benutzeroberfläche“ Österreichs und gar einer ehemals protestantischen und dann stark deutschnational geprägten Stadt wie Graz versteckt mehr die Wirklichkeit, als dass sie gegenwärtige Realität repräsentierte.
Der österreichische „Kulturkatholizismus“ verbindet allgemeine volkskirchliche Strukturmerkmale mit der spezifisch österreichischen kulturprägenden Kraft der dominierenden katholischen Religion. Definiert man „Volkskirche“ durch die Merkmale biografische wie gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, Ressourcenreichtum und institutionelle wie personelle Nähe zur Macht, dann zeigt sich, dass die österreichische Kirche all dies besaß und partiell noch besitzt, aber gegenwärtig dabei ist, all dies zu verlieren.
Die Benennung „Kulturkatholizismus“ ist parallel zu jener des „Kulturprotestantismus“ gebildet. Dieser entstand bekanntlich, als die protestantische Theologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts „zwischen reformatorischer Tradition und moderner, in der Aufklärung entstandener Kultur zu vermitteln“ 84suchte. Genau das aber war auch das Programm von Josephinismus und „Katholischer Aufklärung“ in Österreich. Das Spezifische dabei: Diese Verbindung von Aufklärung und katholischer Tradition war eingewoben in das ältere Konzept einer großen Nähe von „Thron und Altar“, war mithin ein stark obrigkeitliches Konzept. War der Kulturprotestantismus vor allem ein Gelehrtenprojekt mit politischen Konsequenzen, so der „Kulturkatholizismus“ Österreichs ein Unterfangen der Herrschaft mit breiter Ausstrahlung in Wissenschaft und Künste hinein.
Natürlich wissen heute die im Umfeld der dauer(mit)regierenden ÖVP angesiedelten katholischen Kreise, dass es mit dem Kulturkatholizismus nach und nach vorbei ist. 85In Wien etwa haben laut Volkszählung 2001 die Katholiken und Katholikinnen bereits die Bevölkerungsmehrheit verloren. 86Zudem existiert in Österreich immer noch ein relativ starkes sozialistisches Milieu, und die Erinnerung an den Bürgerkrieg im Februar 1934 zwischen „Roten“ und „Schwarzen“ ist noch keineswegs völlig verblasst. Aber die Nähe der kirchlichen Repräsentanten zu wesentlichen Teilen der politischen Macht und umgekehrt die Nähe vieler Politiker zur Kirche, die Alltäglichkeit katholischer Symbole und Riten, die starke kulturelle Prägekraft des Katholizismus, all dies führt immer noch dazu, Österreich als „katholisches Land“ und in Österreich die Wirklichkeit durch eine irgendwie katholische Brille wahrzunehmen, was immer das dann im Einzelnen genau heißen mag.
Mag das alles, wie der aufmerksame Beobachter schnell spürt, viel weniger reale Substanz haben, als es scheint, so belegt doch gerade die aufrechterhaltene Katholizismusfiktion, wie stark das „kulturkatholische“ Konzept nachwirkt. Seine Wahrnehmungsstrukturen sind mehr oder weniger klassisch bürgerlich: wert- und leistungsorientiert, normalisierend und individualisierend und mittlerweile von kirchlicher Partizipation teilweise entkoppelt.
3.2 „Katholikale Reaktion“
Gegen die aufrechterhaltene Katholizismusfiktion des immer noch vorherrschenden und herrschaftsnahen Kulturkatholizismus protestiert(e) nun niemand standhafter als der katholikale Flügel des österreichischen Katholizismus. Seine große Zeit in der jüngeren Kirchengeschichte begann, als Mitte der 1980er Jahre eine Serie von Bischofsernennungen von Rom initiiert wurde, die offenkundig einen kirchenpolitischen Kurswechsel in der österreichischen Kirche einleiten sollte.
Nicht mehr volkskirchliche Durchdringung von Politik und Kultur war das Ziel, sondern markante und profilierte Darstellung „katholischer Positionen“ etwa in Morallehre und Liturgie. Das schloss eine spezifische Distanz zur ÖVP und ihren „kulturkatholischen“ Konzepten ein. Die Nähe der ÖVP zur Aufklärung in einer spezifischen katholizismuskompatiblen Variante ist katholikalen Positionen ausgesprochen fremd. Denn hier rekonstruiert man normalerweise, wie innerkirchlich im 19. Jahrhundert und bis weit ins 20. Jahrhundert üblich, eine einzige Abfallsgeschichte von Luther über die Aufklärung, Liberalismus und Marxismus bis in die „hedonistische“, „bindungslose“ und „individualistische“ Gegenwart.
Das Leitmotiv katholikaler Erneuerung ist dabei der Satz: „Alle Macht und Ehre den kirchlichen Amtsträgern“. Paradigmatisch hierfür ist ein Ausspruch, wie er auf der Wiener Seelsorgetagung 1935 fiel: „Es ist katholischer, mit dem Bischof im Irrtum als gegen den Bischof in der Wahrheit zu schreiten“ 87. Damit ist aber auch schon ein zweites Einflussspezifikum des österreichischen Katholizismus benannt: der katholisch dominierte „Ständestaat“ der Jahre 1934-1938. 88
Читать дальше