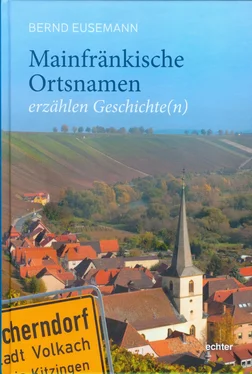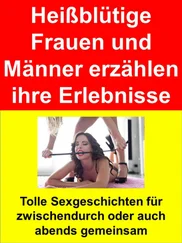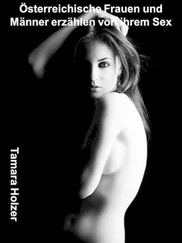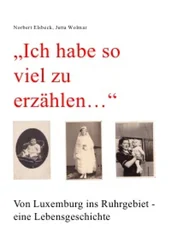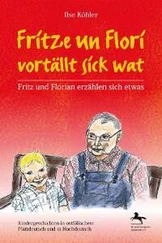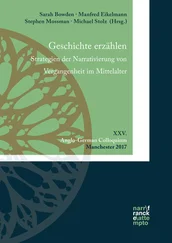Benachbart finden wir weitere Örtlichkeitsnamen mit Wasserbezug, Todtenweisach gleich unterhalb etwa. Der als Totenwissa ebenfalls anno 1232 erstmals genannte Ort enthält das Sumpfwort ‚tot‘ oder ‚tod‘ und den Bachnamen ‚wisaha‘, bezeichnet eine versumpfte Lage am moorigen Bachlauf. Toten- und Todtenbäche plätschern in ganz Deutschland; erinnert sei hier lediglich an den Todtenbach im Schwarzwald mit der Ortschaft Todtmoos, die im Namen so schön das Sumpfige bewahrt. Solche Sprünge sind in der Namenforschung nicht nur erlaubt, sondern zwingend; die Analyse sprachlich offenbar verwandter Namen, vom gleichen Bildungstyp, erschließt oft erst den Sinn und bewahrt vor Fehldeutung aus isolierter Einzelbetrachtung.
Die Weisach, wie sie nunmehr heißt, gab dem heutigen Zentralort Maroldsweisach seinen Namen, 1118 als Landgut Wisaha genannt. Auf welch verschlungenen Wegen dieses – oder der? – Marold in die Urkunden des 14. Jahrhunderts fand, bleibt ein Geheimnis. Wenn traditionelle Namenforschung einen Personennamen wittert, aber keine belegte Person findet, sagt sie: „wohl“. Also ziemlich oft. So sei bei Maroldsweisach ein Maroald im Spiel. Wohl – dem der es glauben mag. Wir begnügen uns mit dem Hinweis auf Marbach nahebei, gelegen am Bächlein des Namens, das wenig weiter in die Weisach mündet, nicht ohne zuvor noch ein Lohr zu durchfließen: Wie jenes bekanntere am Main, genau. Doch da sind wir schon mittendrin in einem alten, langen, heftigen Grundsatzstreit der Namenforschung: dem Lar-Problem. Mit den alten Sumpf- und Wasserwörtern ‚lar‘ und ‚mar‘ und ihrer Zugehörigkeit zum Keltischen oder Germanischen oder noch älteren Sprachschichten werden wir uns später beschäftigen.
Keltomanie ganz eigener Art schwappt seit etlichen Jahren durch Europa. So suchen zum Beispiel unsere französischen Nachbarn daraus nationale Identität zu ziehen – Asterix und Obelix lassen grüßen. Durch deutsche Wälder trampeln maskierte Druiden, Scharen im Schlepptau und suchen Heilkräuter – Auswuchs besonderer Art der Ökobewegung. An wirklichen oder vermeintlichen keltischen Kultstätten sammeln sich Verzückte in besonderen Nächten und geben sich dem Zauber der Kraftorte hin – noch eine Mode spiritueller Sehnsucht und Sinnsuche. So Ihnen jemand von fünftausend Jahre alten keltischen Gefäßen erzählt und weiter, die Kelten hätten nichts Schriftliches hinterlassen: Dann gehen Sie besser auf Habacht. Denn vor fünftausend Jahren gab es noch keine Kelten, nicht sonstwo noch gar in Mainfranken. Ihre Zeit war die Eisenzeit, ihre Spuren finden wir im ersten vorchrislichen Jahrtausend. Das Keltische entstand aus dem Indogermanischen um 1000 vor Christus, sagen uns Sprachforscher; wie und wo genau, darüber streiten sie; ein Favorit ist die Gegend um Lyon am Westalpenrand. Und Kelten kannten Schrift, dazu liegt feine Forschung vor; nicht erst die Inselkelten in Irland und Britannien fingen mit dem Schreiben an; schon vor Christi Geburt gruben die Festlandkelten auf dem Kontinent Inschriften in Steine und Metallplatten, wie Funde aus Frankreich und Spanien zeigen. Sie enthalten – Namen!, sind für die Namenforschung besonders wertvolles Material.
Arme Hummel, oder: Wer martert wen? Schumm ist für viele Überraschungen gut, so wenn er beim Weiler Hummelmarter nicht an ein Marterle denkt, einen Bildstock als den Inbegriff fränkischer Volksfrömmigkeit. Er tippt auf: ‚mar‘ und ‚tar‘, übersetzt das erste als Quelle, das zweite als Baum, Gesträuch. Und findet so: „Ort am hummenden, infolge des Aufenthalts der Bienen summenden Gesträuchs.“ Damit wir’s glauben mögen, rät er zum Vergleich mit dem Hummenwald. Tatsächlich gibt es im deutschsprachigen Raum etliche Ortsnamen mit hummel und hummen oder, noch mehr vereinfacht, Bildungen mit: ‚hum‘, wie ‚hun‘ ein Moorwort. Ohnehin rührt Schumm an den tieferen Sinn, wenn er bei Hummelmarter die Wurzel ‚mar‘ als Quelle ins Spiel bringt. Sie steht allerdings eher für den Quellsumpf als für eine klar sprudelnde Quelle, steckt im gallischen Wort ‚mercasius‘ und blieb erhalten im fanzösischen ‚marais‘, was eben Sumpf und Moor und Morast bedeutet.
Beim schönen Waldfenster erinnert sich Schumm an eine ältere Schreibweise: Waldmannsloch. Er folgt namenkundlicher Methodik, wonach man von der ältesten Form eines Namens ausgeht – und möglichst die ganze Kette der folgenden Schreibweisen im Blick behält. Macht Sinn, zeigt sich in der Praxis aber als dehnbar. Selbst in der Fachliteratur wird das Rohmaterial nicht immer in der Form gereicht, die ein Urteil über die Interpretation erlaubte. Beim Waldfenster greift sich Schumm das ‚loch‘ in einer Bedeutung ‚lueg‘ und versteht dies als Auslug. Eigenwillig, erst recht die Conclusio: „Als der alte Ausdruck fiel, ersetzte man ihn sinnrichtig mit Fenster.“ Wenn schon ‚loch‘ und ‚lueg‘, so hätte er besser über die indogermanische Wurzel ‚lug‘ an schwärzlichen, sumpfigen Boden gedacht. Das wäre überzeugender, zumal dem Walde selbst sprachgeschichtlich das Feuchte innewohnt. Zum Fenster gab es auch Überlegungen, ob sich darin nicht ebenfalls der Sumpf versteckt: ‚fen‘ lautet ein englisches Wort für Moor, und die sprachliche Gemeinsamkeit mit dem ‚Venn‘ liegt auf der Hand.
So ließen sich viele Seiten füllen. Wir könnten fragen, ob die Menschen in Kothen und Kurzewind, Fladungen und Reyersbach Probleme mit der Verdauung hatten. Da bringt man die Lacher schnell auf seine Seite. Hier ging es darum, wie merkwürdige Namen allerlei Deutung provozieren, wie der erste Anschein leicht in die Irre führt. Keinesfalls liegt mir daran, Anton Schumm vorzuführen. Er ist ein typischer Vertreter seiner Zeit, im Kuriosen wie mit treffenden Deutungen. Wir werden ihm auch weiterhin das Wort erteilen, denn für das Verständnis der Namenforschung selbst ist es allemal interessant. Er spukt mit seinen Erklärungen durch die fränkische Namenlandschaft, auch wenn die Nachschreiber meist vergessen, seinen Namen zu nennen.
Mainfränkisches Gelächter ohne Schlüpfrigkeiten? Doch, unsere Landschaft hat Frivoles zu bieten. Jedenfalls dann, wenn wir es in die Namen hineinlesen. Denn diese selbst sind durchaus unschuldig, sogar das lautmalerisch pralle Busendorf. Schumm stellt es zu einem althochdeutschen Wort ‚busc‘, womit aus dem Busendorf ein Buschendorf würde, eins am Gebüsch. Die Erklärung vermag nicht recht zu begeistern. Andere wollen im Busen verborgen einen wieder nicht bekannten Ortsgründer erkennen; oder beim Betrachten der Lage im Gelände springt ihnen eine sinnfällige Wölbung ins Auge; noch eine Variante hört ‚busen‘ und Variationen in Gewässernamen klingen, woraus man auf ein Wasserwort ‚bus‘ schließen möchte. Die Sache ist schillernd, denn wenn wir den Personennamen außen vor lassen, so findet sich vom Busen über den Hügel bis zum Feuchten ein gemeinsamer sprachgeschichtlicher Anschluss. Just in jener Gegend liegen weitere sprechende Ortsnamen, im Grenzbereich Mainfrankens, hart im Bambergischen. Sie fordern genaue Betrachtungen geradezu heraus. Später vielleicht. In einem andern Band über unsere Nachbarregion.
Lauschen wir an einem abschließenden Beispiel, wie sich Bierernst und mainfränkisches Gelächter treffen bei einer Namenverbindung, die Schumm gleich vierfach kennt: Poppendorf, Poppenhausen, Poppenlauer, Poppenroth. Den Jüngeren wird im Alltagsjargon das Poppen für ein gewisses Treiben vertraut sein. Allerdings wissen wir rein gar nichts über die Kraft der Lenden früherer Bewohner. Einen männlichen Gründer will die traditionelle Namendeutung aber schon erkennen: einen Poppo, auch Boppo oder Bobo. Laut Schumm bedeutet dieser Name: der junge Gebieter. Auf thüringische Ansiedelung weise er. Was mich betrifft, so weise ich hin auf den Poppengrund: kein Ort, sondern ein Tälchen, das Pfarrweisach gegenüber sich von der Weisach zum Simonskapellberg streckt. Statt nun auch noch für diesen Wiesengrund einen nirgends erwähnten Poppo zu vereinnahmen, denke ich mit Bahlow an Poppelsdorf am Rhein und Pappenheim an der Altmühl, womit sich für ‚pap‘ und ‚pop‘ ein Sumpfwort erschließt. Was Pappenheim und die Altmühl betrifft, so will ich diese überaus spannende Namenlandschaft gerne in einem Folgeband beleuchten. Selbst mit dem Kanalbau Karls des Großen zwischen Main und Donau können wir die Altmühl nicht Mainfranken zuschlagen.
Читать дальше