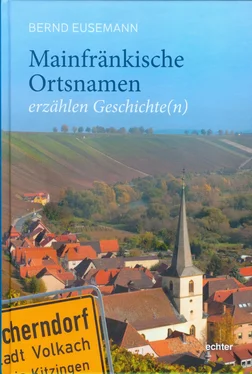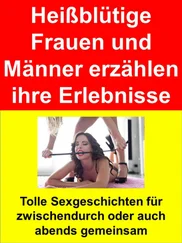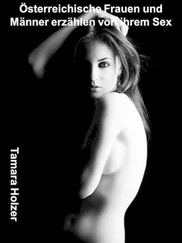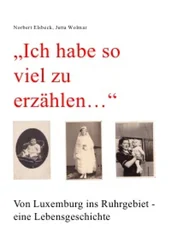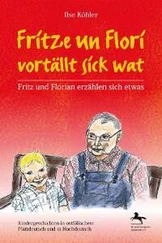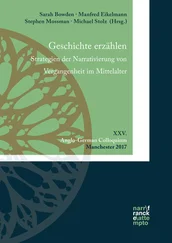Der 1956 verstorbene Heimatdichter Eduard Herold, noch ein Gymnasiallehrer, schrieb über den ‚Mee‘, für die Mainleute sei das eine Art Urbegriff: „Mee ist eben Allgemeinbegriff des Wassers, jeden Wassers, besonders aber des strömenden Wassers, sei es klein oder groß.“ Selbst Buben könne man im Angesicht fremder Rinnsale sagen hören: „Dia hömm ober an kleena Mee!“ Am Oberlauf sagen sie übrigens ‚Maa‘. Und am Unterlauf, in der Rhein-Main-Ebene, nun ja: ‚Moo‘ zu schreiben, träfe es nicht; es ist ein dumpfer Laut zwischen a und o; mit Sonderzeichen ließe er sich darstellen, nicht jedoch mit dem gewöhnlichen Alphabet. Grundproblem aller Schreiber, bevor Schreibweisen festgelegt waren, und gerade der ersten Schreiber, welche zuvor nur Gehörtes zu Papier brachten: Sprache ist eben mündlich, und Namen können aus verschiedenen Mündern höchst unterschiedlich klingen. Keine Überraschung also, wenn Schreibungen oft krass voneinander abweichen; aber eine Herausforderung für die Namenforschung.
Was also sagt nun die Wissenschaft zum Main? Ich weiß nicht, ob Herold sich damit je beschäftigt hat. Aber seine volkskundlichen Betrachtungen zum ‚Mee‘ sind in dem Zusammenhang schon sehr bemerkenswert. Denn immerhin darüber besteht in der Namenkunde weitgehend Einvernehmen: Die ältesten Gewässernamen – sie bestehen meist aus einer Silbe – bezeichnen immer das Wasser selbst, eine mit ihm verknüpfte Eigenschaft. Damit sind wir die Schlange los, die ihre Urheber ob der Form des Mainlaufes – Maindreieck, Mainviereck – ersannen: gewunden wie eine Schlange. Für keltisch erachten ihn gleichwohl viele: Erstens folgen Main und Rhein – der ebenfalls keltisch sei – sprachlich dem gleichen Bildungstyp; zweitens fließt auch in Irland ein ‚Maín‘, ‚Maoin‘. Aber: Im Baltikum finden wir ein lettisches Wort ‚maina‘ für Sumpf.
Allweil spannend ist es nun, nach indogermanischen Wurzeln zu suchen, die hinter solcher Vielfalt stecken. Diese Wurzeln kann man sich als einfache, urtümliche Elemente vorstellen, die dann in den einzelnen Sprachen der indogermanischen Gruppe Wörter bildeten. Eine beträchtliche Zahl der Wurzeln ist begrifflich verbunden mit: feucht, sumpfig, modrig, fließen, entspringen. So kennen die Wörterbücher eine indogermanische Wurzel ‚mā-no-‘, ‚mā-ni-‘ im Sinne von feucht und nass, die zum altirischen Wort ‚moin‘ für Moos und Sumpf, auch Torf leitet. Doch kennen sie ebenso eine Wurzel ‚mei-‘ im Sinne von wandern, gehen; sie steckt hinter Flussnamenwörtern wie mein-, moin-, min- und trug zur Bildung vieler Flussnamen bei. Manche sehen hier die sprachliche Quelle des Mains. Vorne dreht sich der Forscherdisput um Fragen, ob etwa ein kurzer oder ein langer Vokal zu diesem oder jenem Worte führt. Dahinter geht es ganz menschlich auch darum, ob wir die Welt als modrigen Sumpfpfuhl sehen oder lieber erhaben: der Main ein mooriges Wasser oder ein stolzer Strom?
Mit sprachlichen Mitteln allein wird sich der Gegensatz niemals lösen lassen. Die wirkliche Welt bietet beides, das Faulige und das Schöne. Die Namenwelt bildet es ab. Deutung schließlich liest nicht nur heraus, sondern legt auch hinein: Mit vernünftigen Annahmen zwar, die mehr oder minder plausibel, jedoch allesamt vorwissenschaftlich sind: Es liegt nahe zu glauben, die frühen Benenner hätten Eigenschaften wie gutes und schlechtes Wasser, fruchtbaren Boden oder morastigen Grund benutzt; eine andere Frage ist die nach Beweisen. Ebenso verständlich der Versuch, Namen mit Personen zu verbinden; allein, wo bleiben die Belege? Solche Fragen werden uns beschäftigen.
Mainfranken umschreibt – ja, was? Klar, für Schoppenfreunde: Mainfranken ist Weinfranken. Doch sonst? Zeigt sich Mainfranken als Kunstprodukt: Ganz wörtlich, ein Professor erfand das Wort, um eine Kunstlandschaft zu fassen. Das war während der 1920er Jahre. Nicht lange danach benutzten die Nationalsozialisten den Begriff für ihre Neuordnung der deutschen Lande. Nun bezeichnete er ein Gebiet, eine Raumschaft, eine Verwaltungseinheit. Heute deckt sich Mainfranken ungefähr mit dem weniger prosaischen Unterfranken, das mit Ober- und Mittelfranken Bayerns Norden krönt.
Über den Main haben wir gesprochen. Wie steht es nun mit Franken? Nun ja, wird man sagen, als die Franken ihr Reich westlich des Rheins gefestigt hatten, lockte der Osten. Die Merowinger, dann die Karolinger eroberten das Land um den Main. Das Gebiet und seine Bewohner bildeten freilich keine Einheit in den damals gebräuchlichen Bezeichnungen. Erst allmählich bürgerte sich Franken als Name für die Region ein. Darin liegt sogar eine besondere Ironie: Obwohl die Franken nicht von hier stammten und sich ein europaweites Reich eroberten, blieb ihr Name gerade an unserm kleinen Raum haften. Was aber bedeutet nun das Wort?
Franken sind schnell fertig: ‚frank‘ meint frei, der Franke ist der Freie, die Franken die Tapferen und Stolzen. Ach ja, wer schmückt sich nicht selber gern? Solche Erklärung bieten selbst die Gelehrten. Doch ganz gemütlich ist denen dabei nicht. Deswegen finden wir meist verschämt: Es meine „wohl“ frei. Sicher wissen wir nur: Es waren die Römer, die einen bunten germanischen Haufen so nannten. Um 250 tauchen die Franken in den schriftlichen Quellen auf, am Niederrhein hausend. Wie sie auf den Namen kamen, hinterließen uns die Römer nicht. Manche vermuten, sie hätten ihn von Kelten gehört. Jedenfalls ist es, von den Franken aus betrachtet, eine Fremdbezeichnung: Sie übernahmen diese, nachdem aus Einzelstämmen so etwas wie ein Volk gewachsen war. Trotz mancher Versuche, dem Namen eine germanische Basis zu geben, gilt er vielen Forschern als ungeklärt. Die Franken suchten selber schon früh ihre Herkunft zu ergründen. Und landeten – sich selbst überhöhend – im Mythos: Abkömmlinge der Trojaner wollten sie sein, wie zuvor schon die Römer, von denen sie so viel übernahmen, als deren rechtmäßige Erben sie sich verstanden.
Nun zeigen indogermanische Wörterbücher für Völkernamen oft Ableitungen von Wasserwurzeln: Völker werden damit Sumpfbewohner, provozierend gesagt. Obwohl in grauer Vorzeit, als man sie so benannte, damit vielleicht allein eine Herkunftsbezeichnung gemeint war. Die sehr viel jüngeren Familiennamen folgen dem gleichen Schema: Etliche weisen ihren Träger als – ursprünglichen! – Siedler am Sumpf oder Gewässer aus. So sieht Hans Bahlow auch die Franken. Er fährt eine ganze Reihe an Orts- und Gewässernamen auf, die nach seiner Überzeugung ‚frank‘ als verschollenes Wort für Wasser und Sumpf erweisen. Die Franken seien in lateinischen Schriften direkt so geschildert worden: „zwischen unwegsamen Sümpfen wohnend“, denen der Rheinmündung nämlich. Wäre man als Franke letztlich eine Sumpfpflanze, bräuchte man sich gleichwohl nicht herabgewürdigt fühlen: Vor den Sümpfen hatten die Römer höllischen Respekt; sie waren ein wichtiger Verbündeter der Germanen, als sie die römischen Legionen vernichtend schlugen, bei aller Tapferkeit.
Hans Bahlow – kein Lehrer – gilt im Kreise teutomaner Namenforschung als Unperson. Germanist von der Ausbildung, arbeitete er an den Universitäten Rostock und Hamburg als Bibliothekar. Er entwickelte eine Methode des Vergleichens, um verklungenen Wurzeln und dem Sinn alter Namen auf die Schliche zu kommen. Sie fand heftige Kritik. Ernsthafte Auseinandersetzung mit Inhalten suchte die traditionelle Namenforschung aber nicht gerade. Freilich wirkt sein Hauptwerk über „Deutschlands geographische Namenwelt“ fast privat, so schwer macht er es den Lesern. Quellen und Literatur fehlen meist, die Systematik ist nicht gerade eingängig. Lässt man sich aber darauf ein, ist es ungemein anregend. Prüfen muss man immer: Bei ihm wie bei den Traditionalisten. Bahlow starb 1982. Seine Gegner überzogen ihn noch postum mit Hohn. Die Pein scheint wirklich groß.
Читать дальше