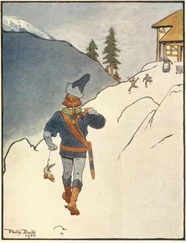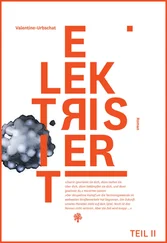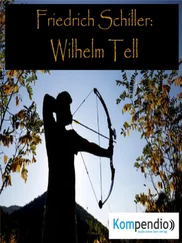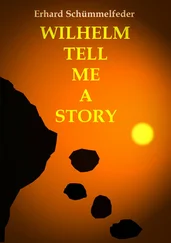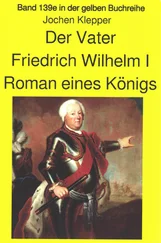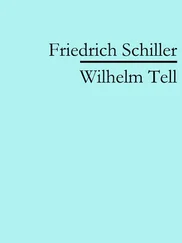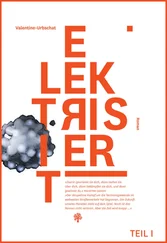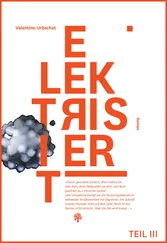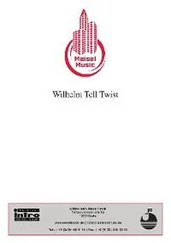Erzählungen handeln deswegen von abgeschwächten, uneindeutigen Kausalitäten. Sie müssen einen Bruch mit den Erwartungen der Zuhörer vollziehen, aber dieser Bruch muss selbst neuen Sinn erzeugen. Glaubwürdig wird dabei derjenige Erzähler, der einen solchen Ausnahmefall überzeugend mit einem Akteur und einer Absicht versehen kann. Ohne einen ordentlichen Helden geht das nicht. «Der Held ist unverzichtbar», so Koschorke trocken, «weil er erfolgreich Sinn reduziert.»
Und Kommentare produziert, könnte man ergänzen. Wer im 21. Jahrhundert über Wilhelm Tell schreibt, sieht sich im Wortsinn Bergen von Literatur gegenüber – es gibt vermutlich keine andere Figur der Schweizer Geschichte, über die auch nur annähernd ähnlich viele gelehrte Bücher geschrieben worden sind. 3Blättern wir nach. Was hat den Mann mit der Armbrust so unwiderstehlich und verlockend gemacht?
Es ist der Michaelstag 1854 in Sarnen, als Gerold Meyer von Knonau im Archiv des Kantons Obwalden die Zeilen «Nu was da ein redlicher man hiess der thäll» entdeckt. 4Gerold Meyer von Knonau ist Staatsarchivar des Kantons Zürich. Die Obwaldner Regierung hat ihn gebeten und beauftragt, das Archiv des Kantons Obwalden «zeitgemäss» in Ordnung zu bringen. 5Dabei kommt ihm ein handgeschriebenes «Copialbuch» aus dem 15. Jahrhundert in die Hände, 508 Seiten aus gutem, weissem Papier zwischen zwei soliden Buchdeckeln aus Holz, 30 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter breit, eingebunden in weisses Schweinsleder, 6auf dem Einband die Notiz «Das sogenante älteste / weiße Bůch / oder / Abschriften der / alten Bündnüßinen». 7Fast zuhinterst, auf Seite 447, der «thäll». 8
Gerold Meyer von Knonau weiss, dass er eine Sensation in seinen Händen hält, den ältesten Beleg für den «thäll». Er bespricht seinen Fund mit Kollegen, und offenbar macht die Entdeckung schnell die Runde, zu schnell für Gerold Meyer von Knonau. 1856, ein Jahr ehe er selbst seinen Fund sorgfältig kommentiert und «mit Bewilligung der Hohen Regierung von Obwalden» in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen kann, 9berichtet er gleich selbst in der «Neuen Zürcher Zeitung» von seiner Entdeckung und druckt vorsorglich – auf dass ihm niemand die Ehre der Erstveröffentlichung streitig macht – schnell ein paar Zeilen aus dem Buch. 10Der älteste Beleg für Tell macht offenbar nervös. Bis heute hat man noch keinen älteren Beleg gefunden.
Doch was genau hat Gerold Meyer von Knonau 1854 im sogenannten «Weissen Buch von Sarnen» entdeckt? Es sind knapp zwei Seiten Text. Tell heisst darin zwar noch nicht Wilhelm, sondern einfach «Tall» oder «Thaell», sonst ist uns das Meiste vertraut, zum Beispiel der Apfelschuss: «Nu was der Tall gar ein gut schütz er hat öuch hübsche kind die beschigt der herr zu jmm / vnd twang den Tallen mit sinen knechten / das der Tall eim sim kind ein Öpfel ab dem höupt Müst schiessen / denn der herr leit dem kind den Öpfel vf das höupt / Nu sach der Thall wol das er beherret was / vnd nam ein pfyl und stagt jnn jn sin göller den andern pfyl nam er jn ein hand / vnd spien sin armbrest / vnd bat got das er jmm sins kind behuete / vnd schös dem kind / den Öpfel ab dem höupt / Es geviel dem herren wol (…).» 11
Der tyrannische Landvogt Gessler, der in Altdorf eine Stange mit seinem Hut aufstellt und verlangt, dass man den Hut so ehrerbietig grüssen soll, als wäre er selbst anwesend. Tell, der diesen Gruss verweigert und als Strafe dem eigenen Kind einen Apfel vom Kopf schiessen muss – und trifft. Die Verhaftung des Tell, der Sturm auf dem Urnersee und Tell, der sich mit einem Sprung aus dem Schiff auf die «Tellen blatten» rettet, nach Küssnacht eilt, dem Landvogt Gessler in der Hohlen Gasse auflauert, ihn mit seiner Armbrust erschiesst und über die Berge wieder entkommt. All das ist auf den zwei Seiten kurz und prägnant erzählt.
Eingebettet ist die Geschichte des Tell in eine kurze Chronik mit dem Titel «Jtem / der anefang der drÿer lendern Uri Switz und vnderwalden (…)». 12Auf nur 25 Seiten wird die Geschichte der drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden erzählt, deren Herkunft, Bündnisse und Kriege vom antiken Rom bis ins Jahr 1426. Den «anefang» oder Ursprung bilden die alten römischen Freiheitsrechte der drei Orte, als sich Römer in Unterwalden und Schweden in Schwyz ansiedeln. Die Geschichte berichtet, wie die Habsburger – erst später – in die Nähe der drei «lender» kommen, was der römische König Rudolf von Habsburg ihnen verspricht, wie nach dem Tod des Königs dessen Vögte hochmütig werden und wie die drei Länder auf dem Rütli den Schwur leisten. Erzählt wird, wie man den einen Vogt beim unsittlichen Baden in Altzellen erschlägt, wie ein anderer Landvogt namens Landenberg im Melchtal Ochsen wegführen und den Bauern blenden lässt, wie Stauffacher in Schwyz sein Steinhaus an einen dritten Vogt namens Gessler verliert, wie Tell den Landvogt Gessler tötet, wie die «Eidgnossen» die Burgen der Landvögte erobern und den letzten noch lebenden Landvogt, Landenberg, vertreiben. 13
Doch das Weisse Buch von Sarnen ist kein Geschichtsbuch und schon gar kein Buch über Wilhelm Tell. Das Buch befindet sich heute im Staatsarchiv des Kantons Obwalden, in der Obhut der staatlichen Verwaltung, und da ist es in den 1470er-Jahren auch entstanden, auf der Kanzlei des Standes Unterwalden ob dem Wald in Sarnen, angelegt vom damaligen Landschreiber Hans Schriber. 14Von den 508 Seiten des Weissen Buches sind knapp die Hälfte, 225 ½ Seiten, mit schöner, sorgfältiger Handschrift beschrieben. Die meisten Einträge stammen aus den Jahren 1470, 1471 und 1472, vereinzelte Nachträge aus späteren Jahren, der letzte Eintrag aus dem Jahr 1607. Die Geschichte der drei «lender», in der Handschrift von Hans Schriber, umfasst nur 25 Seiten. Die übrigen 200 ½ beschriebenen Seiten im Weissen Buch von Sarnen enthalten vor allem: Abschriften von Rechtsdokumenten – Bündnisse mit anderen eidgenössischen Orten oder mit Fürsten, Privilegien und Freiheiten, wichtige Verträge und Gerichtsurteile zu Grenzbereinigungen, zur Erbschaftssteuer, zur Fischerei auf dem Alpnachersee und so weiter. Kurz: Alles, was man zur Staatsführung eines vormodernen Gebildes an Informationen und Grundlagen benötigt. Das Buch hat ein ausführliches Register. Es ist ein Nachschlagewerk. Die einzelnen Rechtsdokumente sind zudem thematisch geordnet. Bei jedem Themenbereich sind am Schluss noch ein paar Seiten freigelassen, um spätere Urkunden oder Verträge nachführen zu können – daher die vielen leeren Seiten. Wird ein Bündnis durch ein neues ersetzt, wird der Text des alten, ungültigen Bündnisses durchgestrichen. 15Es ist ein Handbuch für die Arbeit des Landschreibers und des Landammanns. Und so sieht es auch aus.
Das Buch wird an Kanzleien nach Stans oder Altdorf ausgeliehen, damit diese die wichtigsten Dokumente abschreiben können. Spezialisten aus anderen eidgenössischen Orten konsultieren bei Recherchen auf der Obwaldner Kanzlei auch das Weisse Buch. Man weiss von Abschriften oder Auszügen in St. Gallen, Glarus und Luzern. Irgendwann im 17. Jahrhundert, nicht lange nach dem letzten Eintrag von 1607, wird das Register erneuert, das gesamte Buch zur Sicherung noch einmal abgeschrieben und in neues, weisses Schweinsleder eingeschlagen. Noch einmal hundert Jahre später schreibt jemand auf das weisse Schweinsleder: «Das sogenante älteste / weisse Buch / oder / Abschriften der /alten / Bündtnüssinen». In den Augen der Kanzlei des 18. Jahrhunderts enthält das Buch also nicht mehr aktuelle und gültige, sondern nur noch «alte» Rechtsgrundlagen, nichts, was man bei der alltäglichen Arbeit auf der Kanzlei noch benötigt. Die Logik des Büros: Es wird zwar nicht mehr gebraucht, liegt aber doch noch eine Weile herum. Vielleicht kann man es ja irgendwann noch irgendwie verwenden. Ein paar der unbeschriebenen Blätter des Weissen Buches – weisses Papier in hervorragender Qualität – werden herausgeschnitten und anderweitig verwendet. Braucht man Platz, legt man es woanders hin und vergisst es – bis Gerold Meyer von Knonau am 29. September 1854 das Buch wieder in Händen hält.
Читать дальше