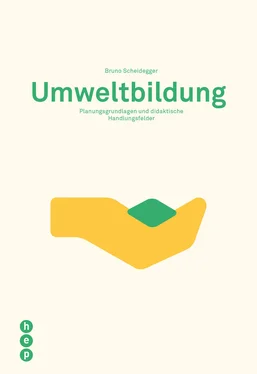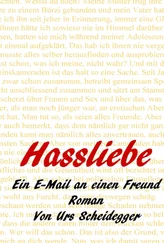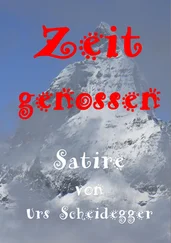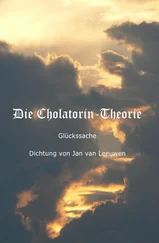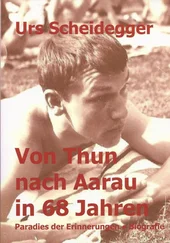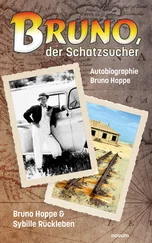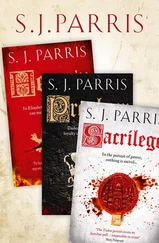Stellen Sie sich also eine Brücke vor, ein kräftiges Bauwerk aus Steinblöcken und Balken, wie wir sie in weniger entwickelten Regionen zum Teil noch heute antreffen. Auf der Brücke herrscht reger Verkehr, Menschen, Tiere und Fuhrwerke sind in beide Richtungen unterwegs. Ein Trupp Männer und Frauen ist an einer Stelle damit beschäftigt, die Fahrbahn und das Tragwerk auszubessern, ohne den Verkehr weiter zu behindern. Die Menschen sorgen dafür, dass die Brücke ihre Funktion erfüllt und sich den Anforderungen des Verkehrs laufend anpasst.
Die Bücke ist eine Metapher für die Interaktion des Subjekts mit seiner Mit- und Umwelt. Verhalten, Lernen, Bildung sind das Resultat dieser Interaktion zwischen Innen und Außen. Die Fahrbahn der »Gewohnheiten« deutet an, dass unsere Interaktionen vorwiegend von habitualisierten Handlungsmustern getragen werden, und der Fluss symbolisiert die Veränderung. Jedes Verhalten ist in einer historischen Zeit, an einem geografischen Ort und in einem sozialen Umfeld verortet. Die Voraussetzungen für unser heutiges Verhalten haben wir gestern erworben, und was wir im jetzigen Moment lernen, werden wir morgen in einer neuen Situation anwenden. Umweltbildung soll die Menschen zum Ausbruch aus ihrer subjektiven Wirklichkeit anstiften. Ihre Aufgabe erfüllt sie, wenn ein reger Austausch zwischen dem Subjekt und der Welt stattfindet und die Brücke laufend rekonstruiert wird.
… alles Komplizierte ist praktisch unbrauchbar
Nach mehr als 45 Jahren Umweltbildungsforschung besteht in der Fachwelt weitgehend Einigkeit zu einigen Rahmenbedingungen und Herausforderungen:
♦Umweltbildung ist Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Um erfolgreich zu sein, benötigt sie Erkenntnisse aus den Natur- und Geisteswissenschaften. Rein naturwissenschaftliche Zugänge haben sich nicht bewährt.
♦Umweltprobleme sind keine objektiven Gegebenheiten. Sie werden von unterschiedlichen sozialen Gruppen und Individuen unterschiedlich wahrgenommen, bewertet und definiert. Die Menschen müssen die Bereitschaft und Fähigkeit entwickeln, sich am »manchmal mühsamen Prozess des Debattierens, Klärens und Verhandelns« zu beteiligen (Kyburz-Graber, Halder, Hügli & Ritter, 2001, S. 241).
♦Mehr Wissen oder größere Betroffenheit allein führen nicht zu umweltfreundlicherem Verhalten (vgl. Kuckartz & de Haan, 1996). »Die in vielen Initiativen zur Umweltbildung angelegte implizite Prämisse, vom Wissen über Einstellungen zum veränderten Verhalten zu gelangen, lässt sich empirisch nicht halten« (Bolscho & de Haan, 2000, S. 9).
♦Lösungsansätze für Umweltprobleme sind vielschichtig. Sowohl die naturwissenschaftlichen Grundlagen wie Klima oder Biodiversität als auch die Bildungsprozesse für umweltgerechtes Verhalten können nicht durch lineares Denken erfasst werden. Die Lösung von Umweltproblemen ist möglich, wenn die Menschen lernen, mit dieser Komplexität umzugehen und die Relativität von Lösungsansätzen zu ertragen (vgl. Kyburz-Graber et al., 2001).
♦Nachhaltige Entwicklung erfordert eine tief greifende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, die nicht mit den bisherigen Entwicklungsstrategien bewältigt werden kann. Nötig ist ein gesellschaftlicher Suchprozess, für den auch Bildung neue Ansätze finden muss (vgl. WBGU, 2011).
Für die Umweltbildung in der Praxis ergibt sich aus diesen Erkenntnissen eine konstante Herausforderung: die Komplexität der Aufgabe. Sie erfordert ganzheitliche, systemische Bildungsansätze mit Maßnahmen auf mehreren Interventionsebenen. Bei der Planung und Bewertung von Umweltbildungsmaßnahmen ist es oft schwierig, die Übersicht über Wirkungszusammenhänge, sinnvolle Ansatzpunkte und notwendige unterstützende Maßnahmen zu behalten.
… alles Einfache ist theoretisch falsch
In der Wissenschaft ist es bei dieser Problemlage üblich, auf Heuristiken zurückzugreifen. Eine Heuristik dient der Orientierung. Sie schafft als Denkmodell Übersicht und macht Beziehungen sichtbar, ohne die Komplexität des Systems zu verleugnen. Das »Brückenmodell der didaktischen Handlungsfelder für verhaltenswirksame Umweltbildung« (siehe Buchklappe) dient in erster Linie der Anschaulichkeit. Als Heuristik erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit mit einer wasserdichten Theorie im Hintergrund. Es will gewisse Aspekte in den Vordergrund rücken und das Denken in eine bestimmte Richtung lenken.
Das Brückenmodell …
♦differenziert didaktische Handlungsfelder nach Verhaltensfaktoren;
♦vereinfacht die Orientierung in den komplexen Wirkungszusammenhängen;
♦zeigt auf, worin die Herausforderung von verhaltensorientierter Bildung liegt;
♦erleichtert die Beurteilung der Wirkung von Umweltbildungsangeboten;
♦hilft, die Möglichkeiten und Grenzen pädagogischer Einflussnahme zu verstehen;
♦ist in aktuellen theoretischen Konzepten zu Verhalten, Lernen und Wissenstransfer verankert, insbesondere in den Theorien der
–Umweltbildung / Bildung für nachhaltige Entwicklung,
–Verhaltens-, Lern- und Sozialpsychologie,
–Bildungswissenschaft,
–Erwachsenenbildung und des lebenslangen Lernens.
1.4 Anwendung und Adressierte
Als Advance Organizer im Unterricht bietet das Brückenmodell den Studierenden eine mentale Landkarte, mit der sie sich das Fachgebiet »Umweltbildung« sektoriell erschließen können, ohne in der Fülle von Begriffen, Theorien und Betrachtungsdimensionen den Blick auf das Wesentliche zu verlieren, nämlich auf den handelnden Menschen und seine Alltagsrealität.
Bei der Planung und Evaluation von Umweltbildungsangeboten dient das Brückenmodell der Zielgruppen- und Umfeldanalyse. Es hilft mit, das Wirkungspotenzial eines Angebots realistisch einzuschätzen. Es erlaubt, eine Bildungsstrategie zu entwickeln, die alle wichtigen Verhaltensfaktoren berücksichtigt, und es weist den Weg zu passenden didaktischen Ansätzen für die Bildungsarbeit.
Das Brückenmodell dient der subjektiven Theoriebildung, denn Lernen ist mit dem Studium nicht abgeschlossen, es findet in der Praxis seine Fortsetzung und Vertiefung. Die Reflexion von Berufserfahrungen anhand der Heuristik soll Fragen aufwerfen, Zustimmung und Widersprüche erzeugen, bisherige Gewissheiten in einem neuen Licht erscheinen lassen. Gespiegelt an der eigenen Erfahrung, lassen sich die Implikationen des Brückenmodells immer wieder neu interpretieren. Die kritische Auseinandersetzung mit der Gültigkeit des Modells führt zu neuen Einsichten und Erkenntnissen.
Nicht zuletzt richtet sich das Brückenmodell an alle, die sich mit den Wirkungszusammenhängen in der verhaltensorientierten Bildung befassen. In der vorliegenden Publikation werden diese Zusammenhänge am Beispiel der Umweltbildung aufgezeigt. Das Brückenmodell gilt jedoch für jede Art von verhaltensorientierter Bildung, wie Gesundheitsbildung oder Bürgerbildung, indem es systemisch vernetzte Wirkungszusammenhänge grafisch vereinfacht und auf ein Grundmodell für menschliches Erleben und Verhalten zurückführt.
2 Theoretische Fundierung
♦ Jedes Verhalten resultiert aus einer Wechselwirkung
von Person und Umwelt. ♦
Kurt Lewin
2.1 Grundmodell der Verhaltenserklärung
Das Brückenmodell basiert auf dem »psychologischen Grundmodell zur Beschreibung und Erklärung von menschlichem Verhalten« von Hans-Peter Nolting und Peter Paulus (1999). Die Autoren ordnen die Verhaltensfaktoren in fünf Bereiche und stellen diese auf drei Ebenen dar (vgl. Abbildung 1). Sie wählen als Ausgangspunkt das von außen beobachtbare Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation. Die erste Ebene des Grundmodells beschreibt das Verhalten und die dazugehörigen inneren Prozesse. Die zweite Ebene fragt nach den personalen Dispositionen und situativen Bedingungen, die diese aktuellen Prozesse im Zeitpunkt des Verhaltens beeinflussen. Die dritte Ebene schließlich umfasst die Entwicklungsbedingungen, unter denen sich die aktuellen personalen Verhaltensfaktoren entwickelt haben.
Читать дальше