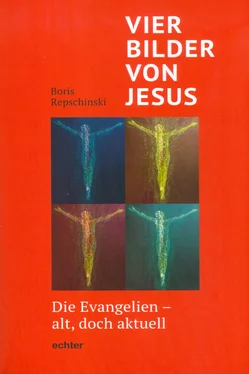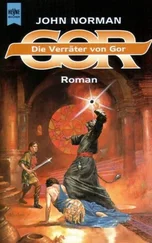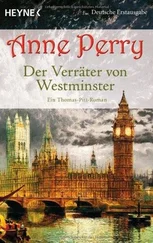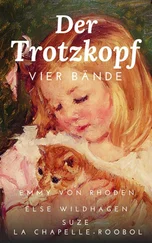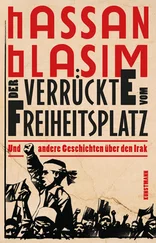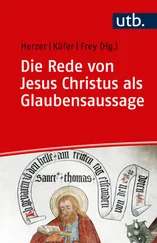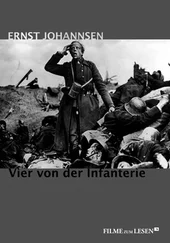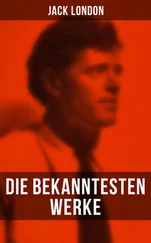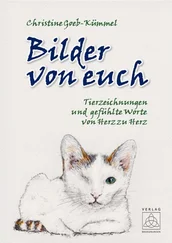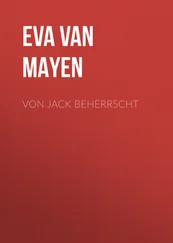– Die Evangelien sind keine Geschichtsschreibung des Lebens Jesu. Zwischen beiden liegen Jahrzehnte theologischer und pastoraler Aufbereitung der Jesusmaterialien. Manchmal ist es mit aufmerksamer und genauer Exegese möglich, Geschichte und Entwicklung voneinander zu trennen. In den seltensten Fällen ergibt das jedoch historische Sicherheit.
– Die These, dass die Evangelien keine historischen Berichte sind, wird manchmal dahingehend interpretiert, dass sie keine wahren Berichte über Jesus sind. Diese Interpretation wird allerdings dem theologischen und pastoralen Zweck der Evangelien nicht gerecht. Es ist viel eher plausibel, dass die Entwicklungen in der Traditionsbildung mit den historischen Ereignissen in einer Kontinuität stehen, als dass die Tradition die historischen Ereignisse grundsätzlich verdeckt.
– Solch ein Ansatz zu einer Antwort auf die Frage nach der Wahrheit der Evangelien ist für manche nicht zufriedenstellend, weil sich wohl nicht mehr endgültig entscheiden lässt, wie treu die Autoren dem historischen Jesus wirklich waren. Mehr noch, wie treu sind die Evangelisten der ursprünglichen Botschaft Jesu? Dies ist natürlich eine theologische Frage, die auch eine theologische Antwort in der Annahme der Schriftinspiration hat.
– Evangelienharmonien wie Tatians Diatesseron aus der Mitte des 2. Jahrhunderts oder das mittelalterliche Leben Jesu des Ludolfvon Sachsen sind daher auch sowohl historisch wie theologisch als Fehlleistung einzustufen. Historisch, weil sie die unterschiedlichen Traditionsprozesse ausblenden; theologisch, weil sie die gemeinsame Inspiration unterschiedlicher Schriften ablehnen.
C. Und zurück: Die Frage nach dem historischen Jesus
Obwohl die Evangelien nicht als historische Biographien gelesen werden können, sind sie doch die Hauptquellen für die Rückfrage nach dem historischen Jesus. Dass Jesus existiert hat, wissen wir auch durch Flavius Josefus und durch die Annalen des römischen Geschichtsschreibers Tacitus, der von der Hinrichtung Jesu durch Pontius Pilatus berichtet. Aber darüber hinaus geben diese Quellen keine weiteren Informationen.
Will man nun historische Details aus dem Leben Jesu herausfinden, ist man auf die Evangelien angewiesen. In der Forschung hat sich seit dem 18. Jh. ein Instrumentarium entwickelt, mit dem man versucht, den von den Evangelien verkündeten Christus vom historischen Jesus zu trennen. Die Suche nach dem historischen Jesus begann ernsthaft im 19. Jh. Eine zweite Welle folgte in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Seit dem Ende des 20. Jh.s ist die dritte Welle noch nicht abgerissen.
Zu den in der historischen Jesusforschung verwendeten Methoden gehört vornehmlich die historisch-kritische Methode mit ihren verschiedenen Unterschritten. Sie erweist sich vor allem deshalb als immer noch geeignet, weil besonders seit dem Zweiten Weltkrieg die Erforschung und das Wissen um das Judentum zur Zeit Jesu enorme Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig sucht man mit Hilfe von Formkritik und Quellenkritik nach den ältesten in den Evangelien erhaltenen Traditionen. Ältere Materialien werden als glaubhafter angesehen als jüngere Entwicklungen in der Tradition.
Gelegentlich findet man in den Evangelien Anachronismen, die dem Interesse späterer Gemeinden geschuldet sind. So dürfte Mt 18,17 mit der Aufforderung, Konflikte unter den Jüngerinnen und Jüngern zur Kirche zu bringen, wohl eine späte Gemeindeentwicklung sein, die auch für die Erklärung von Petrus als dem Fels, auf den Jesus seine Kirche baut, verantwortlich gewesen ist. Der Begriff „Kirche“ wird Jesus fremd gewesen sein. Auf der anderen Seite sind Hinweise auf die Angehörigen, die Jesus für verrückt erklären und nach Hause bringen möchten (Mk 3,21), wohl historisch zuverlässig. Für eine spätere Gemeinde ist eine solche Geschichte dermaßen peinlich, dass Matthäus und Lukas sie nicht mehr berichten.
Zu beobachten ist, dass die verschiedenen Forscher jeweils Rekonstruktionen vorlegen, die hypothetisch sind. Drei Hauptthemen kehren mit unterschiedlichen Akzenten immer wieder:
– Erstens beschäftigt die Frage nach dem Verhältnis Jesu zum Judentum seiner Zeit. So wird er als unkonventioneller Jude, als marginaler Jude, als jüdischer Mystiker und Wundertäter oder auch als endzeitlicher Prophet beschrieben. Umstritten ist, ob Jesus sich selbst als Messias betrachtete. Oft wird diese Frage auch generell gestellt: Welches Selbstverständnis hatte Jesus?
– Zweitens wird immer wieder auf die Frage nach der Haltung Jesu zu religiösen und politischen Autoritäten eingegangen. So wird bei Jesus immer wieder eine Sozialkritik beobachtet, die bestehende Besitzverhältnisse grundsätzlich in Frage stellt. Auch die Predigt von der Gottesherrschaft wird oft als direkte Kritik am Römischen Reich gesehen.
– Drittens wird Jesus als eschatologischer Prediger verstanden, der die nahende Endzeit verkündet, die die Umkehrung aller Werte und Verhältnisse impliziert und die Herrschaft Gottes endgültig aufrichten wird. Umstritten ist in diesem Bereich besonders, ob sich Jesus selbst als den betrachtete, der diese Endzeit nicht nur predigte, sondern in ihrer Herbeiführung eine tragende Rolle einnahm.
Alle drei Themen sind natürlich miteinander verwoben und tauchen mit unterschiedlichen Akzenten in fast allen Jesusbüchern auf.
In den Jesusbüchern wird die Frage der Auferstehung in der Regel ausgeklammert. Dies schuldet sich der Einsicht, dass die Auferstehung für Historiker nicht mehr fassbar ist. Man kann belegen, dass Jesusgläubige von seiner Auferstehung überzeugt waren, aber ob ihnen der Auferstandene tatsächlich begegnet ist, lässt sich weder beweisen noch widerlegen. Hier trennen sich Geschichtswissenschaft und Theologie.
D. Rezeption und Interpretation der Evangelien
Mit der Niederschrift der Evangelien beginnt der Prozess der Rezeption und Interpretation. Die enorme Anzahl der Abschriften, die schon in der Antike unternommen wurden, geben Zeugnis von der schnellen und weiten Verbreitung der Evangelien. Inmitten dieser Vielfalt von Manuskripten besteht die erste Aufgabe darin, einen Text zu sichern, der möglichst nahe am Original ist.
a. Textkritik
Die ursprünglichen Texte sind nicht mehr erhalten, doch existieren Fragmente von Abschriften, die bis in das 2. Jh. zurückreichen. Allein an griechischen Fragmenten und vollständigen Texten sind über 5000 verschiedene Manuskripte erhalten. Dies ist auch für heutige Verhältnisse eine hohe Zahl, bedenkt man dazu noch, dass die Kopien von Hand angefertigt wurden. Die moderne Textkritik macht sich zur Aufgabe, aus den verschiedenen erhaltenen Fragmenten einen Gesamttext herzustellen, der möglichst nahe an die ursprünglichen Texte herankommt.
Dies bedeutet, dass der heute zugängliche Text ein rekonstruierter Text ist. In weiten Teilen des Neuen Testaments ist die Rekonstruktion mit sehr großer Sicherheit möglich, in einigen wenigen Abschnitten jedoch besteht Unsicherheit bezüglich der originalen Textform. Ein Beispiel für eine solche Unsicherheit ist Mk 1,1. Der rekonstruierte Text lautet: „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes“. Jedoch fehlt in den ältesten Handschriften der Titel „dem Sohn Gottes“ und wird daher als unsicher betrachtet. Moderne Ausgaben des griechischen Textes vermerken solche Unsicherheiten und Variationen in den Manuskripten in einem textkritischen Apparat. Bei gewichtigen Abweichungen werden diese gelegentlich auch in Übersetzungen deutlich gemacht.
b. Übersetzung
Die Aneignung der Texte setzt sich fort in Übersetzungen. Schon für Menschen in der Antike war Griechisch nicht immer verständlich; es entstanden Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Papst Damasus beauftragte den Kirchenvater Hieronymus im Jahr 382 damit, die verschiedenen lateinischen Übersetzungen des Neuen Testaments in der Vulgata zu vereinheitlichen. Sie erfüllte eine ähnliche Funktion wie die Einheitsübersetzung heute, indem sie Liturgie und Bibelstudium für viele Jahrhunderte vereinheitlichte.
Читать дальше