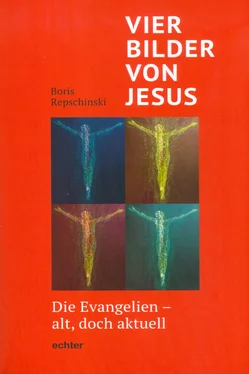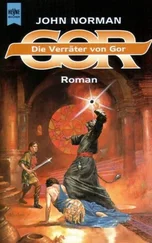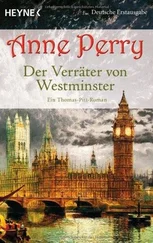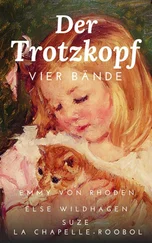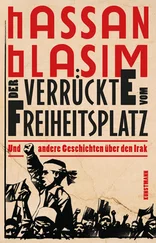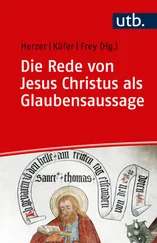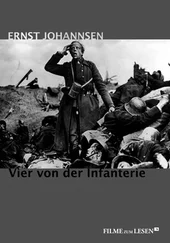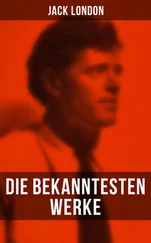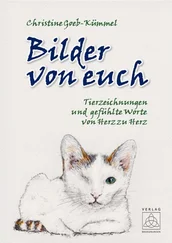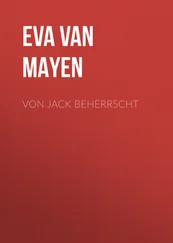Als Zeloten, griechisch für „Eiferer“, bezeichnet man eine Gruppe von Juden, deren religiöse Überzeugung im bewaffneten Widerstand gegen die römische Besatzungsmacht Ausdruck fand. Attentate auf Nichtjuden und kleinere Scharmützel mit Besatzungstruppen begannen mit dem Ende der Herrschaft der herodianischen Dynastie in Judäa im Jahr 6 n. Chr. und lösten letztlich einen Aufstand aus, der im Jahr 70 n. Chr. mit der vollständigen Zerstörung Jerusalems durch die Römer endete.
Die politische Welt der Evangelien ist durch die Besetzung Israels durch die Römer bestimmt, die im Jahr 64 v. Chr. begann. Die Römer setzten zunächst Könige, wie beispielsweise Herodes, danach Prokuratoren und Gouverneure ein, um ihren Machtanspruch sicherzustellen. Lokale Institutionen blieben unter diesen Machthabern bestehen. So behielt der jüdische Sanhedrin als eine Art Senatsregierung gewisse Privilegien. Die römische Oberhoheit machte sich hauptsächlich in Steuern und Abgaben bemerkbar, aber auch durch eine verstärkte militärische Präsenz, deren Kosten von den Besetzten zu bestreiten war. In Fällen von Unruhen griff das Militär hart ein.
Das römische Regierungssystem war von Korruption bestimmt. Zudem gab es keine realistische Beschwerdemöglichkeit, sollte ein römischer Amtsinhaber seine Macht missbrauchen. Geschichten wie die vom Steuereintreiber Zachäus (Lk 19,1–10), der bereitwillig seine Betrügereien zugibt, geben einen Blick auf dieses System frei. Die Habgier des Prokurators Gessius Florus, der während seiner Amtszeit von 64–66 n. Chr. sogar den jüdischen Tempelschatz seinem Privatvermögen einverleiben wollte, war einer der Auslöser für einen Aufstand, der im Jahr 66 begann und vier Jahre später zur Zerstörung Jerusalems führte.
Die sozio-kulturelle Welt der Evangelien ist ein Aufeinandertreffen verschiedener religiöser Überzeugungen, politischer Ansprüche und ethnischer Diversität. Die Evangelien erzählen von Begegnungen Jesu mit Samaritern und Heiden, mit Griechen und Römern und mit vielen Juden aus unterschiedlichen Gruppen. Schon hier wird deutlich, wie stark die Welt der Evangelien von der Auseinandersetzung verschiedenster Strömungen bestimmt ist.
Die Evangelien sind dafür nur ein Abbild der Entwicklung des frühen Christentums. Jesus war ein jüdischer Wanderprediger aus Galiläa, der unter Juden predigte. Aber seine Jüngerinnen und Jünger tragen den Glauben an Jesus als die Erscheinung Gottes unter den Menschen bald nicht nur zu Juden, sondern auch zu Heiden. Das Pfingstereignis in der Apostelgeschichte zählt symbolisch eine Vielfalt von Völkern auf, die plötzlich alle die Sprache der Apostel verstehen (Apg 2,7–11). Damit ist sicher nicht nur die Sprachbarriere gemeint.
Dabei geht es nicht nur um die Begegnung verschiedener Völker, auch verschiedene Kulturen treffen aufeinander. Seit den Eroberungszügen von Alexander dem Großen stand der gesamte Mittelmeerraum unter dem Einfluss griechischer Werte und Philosophie. Man nennt dieses Phänomen den Hellenismus, und auch die Römer entzogen sich dem nicht. Griechisches Gedankengut verband sich mit lokalen Gegebenheiten zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Synkretismus. So gibt es durchaus jüdische Schriften, die sich hellenistischem Gedankengut nicht verschließen. Philo von Alexandrien ist ein gutes Beispiel für einen gebildeten Juden, der die griechische Philosophie mit seinem Glauben verbinden wollte und entsprechende Kommentare zu vielen jüdischen Büchern schrieb. Aber es gab auch Kritiker, die in der neuen Kultur eine Bedrohung sahen. Das erste Makkabäerbuch zeigt dies auf.
In diesen kulturellen Wirren tauchen plötzlich zwei Phänomene auf, die besondere Bedeutung erlangen. Das eine ist die Apokalyptik, die besonders im jüdischen Umfeld Fuß fasst. Sie sieht die Welt als ein Schlachtfeld zwischen den Mächten von Gut und Böse, in der wenige Getreue durch Gehorsam gegenüber der guten Macht gerettet werden. Solche Vorstellungen werden nicht nur in der Offenbarung des Johannes aufgenommen, sondern sie finden auch Eingang in die endzeitlichen Vorstellungen der Evangelien. Ein zweites Phänomen ist die Gnosis, griechisch für „Wissen“. Sie ist eher in hellenistischem Gedankengut beheimatet und sieht in der Aneignung geheimen Wissens den Weg der Menschen weg von einer materiellen und als solcher bösen Welt hin zu einer spirituellen und vergeistigten Existenz, die in ihrer Vollendung Erlösung bedeutet. Auch diese Art des Denkens findet Eingang in die Evangelien und lässt sich besonders gut am Johannesevangelium nachweisen.
C. Sind Evangelien Biographien?
In dieser Welt der Umbrüche entstehen innerhalb der zweiten Generation von Christen die Schriften, die wir Evangelien nennen. In den Schriften treffen moderne Leserinnen und Leser nicht nur auf eine fremde kulturelle Welt, auch die Literaturgattung als solche ist nicht mit dem zu vergleichen, was wir heute als Literatur kennen. Die Evangelien sind keine historischen Romane oder Dramen oder Poesie, und auch Biographien sehen heute anders aus.
Doch ein Vergleich mit antiker Literatur lohnt sich durchaus. In der Forschung wird beispielsweise immer wieder der Vergleich mit antiken Biographien herangezogen. Tatsächlich hatten antike Biographien eine andere Funktion und Form als heutige. Den antiken Autoren ging es weniger um eine historisch möglichst korrekte und anhand von Dokumenten überprüfbare Darstellung von Persönlichkeiten. Sie waren vielmehr interessiert an einer Sammlung von anekdotenhaft erzählten Ereignissen, die dazu dienten, die Lehre einer Person in Schlaglichtern für die Schüler zu erhalten. Philostratus und Diogenes Laërtius schrieben viele Biographien von Philosophen, die auf impressionistische Weise Erzählungen zusammentrugen, die heute oft mit Skepsis bezüglich ihrer Historizität beurteilt werden. Solche Biographien hatten das Ziel, den Beschriebenen Ehre zu erweisen.
Während einige Elemente solcher Biographien sich für den Vergleich mit den Evangelien durchaus anbieten, ist die Identifikation eher schwierig. Zum einen wird Jesus nicht als Philosoph beschrieben, zum anderen verstanden sich die Gemeinden der Evangelien wohl nicht als philosophische Schulen. Während die Evangelien eine Lehre Jesu beschreiben und sie auch für autoritativ erklären, liegt ihr Hauptaugenmerk auf der Person Jesu als Sohn Gottes, Erlöser, als Herr und als Gott. Erst die Person macht auch seine Lehre verbindlich. Das Bekenntnis des Thomas in Joh 20,28 macht dies mehr als deutlich.
Der Fokus auf die Person Jesu wird im Umgang mit seinem Tod greifbar. Die Evangelien mühen sich offensichtlich um eine Sprache, die dem Tod Jesu als einer Art Zeitenwende gerecht wird. Markus tut dies mit der Sprache vom Lösegeld (Mk 10,45); Matthäus sieht im Tod Jesu das endgültige Opfer, das die Sünde vergibt (Mt 26,28); Lukas löst das Problem erzählerisch, indem er den Tod Jesu zum Mittelpunkt seines Geschichtswerkes macht, dessen erster Teil das Evangelium mit der Geschichte Jesu ist, der zweite Teil die Apostelgeschichte mit der Geschichte der frühen Kirche. Johannes spricht von einem Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt (Joh 1,29) und so Gottes Herrlichkeit offenbart (Joh 17,1–4).
Mit diesem Akzent auf der Person Jesu wird der Vergleich mit antiken Biographien jedoch schal. Während die Evangelien durchaus mit antiken Biographien vergleichbar sind, was die Art der Sammlung und Präsentation von Anekdoten angeht, setzen sie sich doch inhaltlich weit von ihnen ab. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass mit den Evangelien eine neue Literaturgattung in Erscheinung tritt.
D. Evangelien als Verkündigung in erzählender Form
Evangelium bedeutet zunächst einfach „frohe Botschaft“. Damit wurde in frühester Zeit zunächst die Predigt Jesu von der Herrschaft Gottes bezeichnet. Der Aufruf „Glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15) drückt genau dies aus. Paulus predigte das Evangelium Gottes, das er dann auch das Evangelium von Christus nennt (Röm 1,1–3). Hier wird deutlich, dass in früher christlicher Predigt nicht nur die von Jesus verkündete Botschaft Evangelium ist, sondern dass Jesus selbst nun zum Inhalt des Evangeliums wird (vgl. 1 Kor 15,1–8). Bei Paulus schließt dies noch keine Berichte über die Taten Jesu mit ein. Für ihn werden lediglich Tod und Auferstehung Jesu Teil des Evangeliums Gottes, das nun auch von Jesus handelt. Möglicherweise findet sich in Apg 10,34–43 eine frühe Predigt, die diese Botschaft von der Zusammengehörigkeit von Gottes Handeln und Jesu Passion und Auferstehung belegt.
Читать дальше