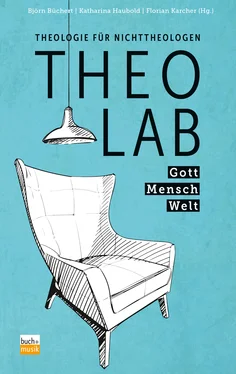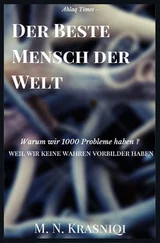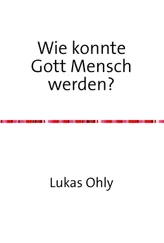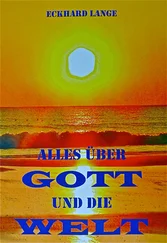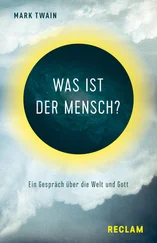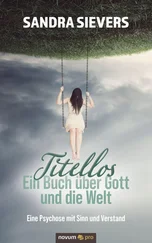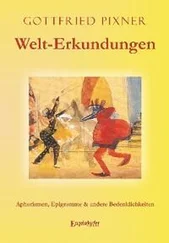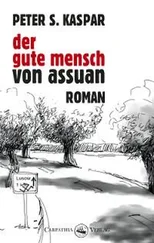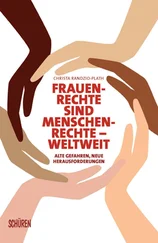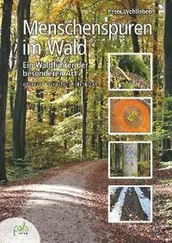Die Bibel ‒ Gottes Personendaten
Die Berichte und Zeugnisse der Bibel sind unsere einzige schriftliche und damit wichtigste Quelle, um Aussagen über Gott zu treffen. Die Art und Weise, in welcher im Alten und Neuen Testament von ihm gesprochen wird, ist deshalb von höchster Bedeutung. Wie stellt Gott sich selbst mithilfe menschlicher Worte darin vor?
In der Geschichte von Moses Berufung (2. Mose 3) wird auf einzigartige Weise eingeführt, wie das Volk Israel künftig mit und über seinen Gott sprechen soll. Auf die Frage Moses nach dem Namen Gottes antwortet dieser nicht mit einem bloßen Begriff, nicht in einem anschaulichen Bild, nicht in einer vermenschlichten Verkleinerung, sondern in einem Versprechen. „Ich werde sein, der ich sein werde“ (2. Mose 3,14 Lu).
Diese Art, über Gott zu sprechen, war nicht nur für Mose und den Rest des Volkes Israel vollkommen neu und ungewohnt, sie unterschied sich auch von allen bekannten Redeweisen über Götter in der Antike. Kanaaniter, Ägypter und Babylonier, die gesamte bekannte Welt ‒ sie alle hatten eine mächtige Götterwelt vorzuweisen, in welcher Gottheiten mit Namen wie El, Baal und Marduk in Standbildern verehrt und angebetet wurden. Das kleine Israel hingegen hatte genau einen Gott. Einen Gott, dessen Wesen und Name niemals in Stein gemeißelt werden sollte. Einen Gott, der sich für alle Zeiten in einem Versprechen an sein Volk binden würde: JHWH ‒ „Ich werde sein“ oder „Ich bin da“ war künftig sein Name. Das Wissen um die genaue Übersetzung der hebräischen Konsonanten des Gottesnamens JHWH ging im Laufe der Geschichte Israels verloren. Aus Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes und aufgrund des Bilderverbots in den Zehn Geboten (2. Mose 20) wurde der Name Gottes nicht ausgesprochen, ohne Vokale notiert und meist einfach mit „HERR“ umschrieben. Die Heiligkeit des Gottesnamens und die große Ehrfurcht davor gelten im Judentum bis auf den heutigen Tag.
Dass „JHWH“ viel mehr ist als ein Name, zeigt sich darin, wie mit seinem Namen umgegangen wird. Vom Namen Gottes geht Macht und Kraft aus, sein Aussprechen bleibt nicht ohne Wirkung. Der Name beschreibt nicht nur die zugehörige Person, er verkörpert sie vielmehr. In anderen Worten: Wo sein Name ist, da ist auch Gott selbst. Für viele Menschen, die nach Gott fragen, haben Kirchengebäude deshalb bis heute eine ganz besondere Bedeutung.
Als das Volk Israel zur Zeit des Königs David dem Drang nicht länger widerstehen konnte, den ewigen und unbeschreiblichen Gott greifbar zu machen, kam es zum Bau des ersten Tempels ‒ deshalb ist auch stets vom Wohnen des Namens Gottes die Rede (1. Kön 8).
Die Menschen verlangte es nach einem sichtbaren Platz, an welchem gebetet werden konnte. Aufgrund der Größe und Heiligkeit des Namens Gottes wurde nun auch der zugehörige Ort als heilig angesehen. Gleichzeitig erkannte man auch damals schon die Problematik einer solchen Festlegung des unendlichen Gottes. König Salomo, der den Tempel selbst errichtete, betete deshalb bereits bei seiner Einweihung voller Demut: „Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen ‒ wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe“ (1. Kön 8,27 Lu)?
Um von Gott zu reden, braucht es neben einem Namen und einem Ort auch eine Beschreibung seines Wesens. Wie verhält er sich? Hat er einen Charakter?
In Anerkennung seiner Größe und Unantastbarkeit wird in der Bibel von Gott einerseits mithilfe verschiedener göttlicher, also übermenschlicher Attribute gesprochen: Er ist ewig, war schon immer und wird bis in alle Zukunft sein (Ps 90,2), er ist allmächtig, nichts ist ihm unmöglich (Jer 32,17), er ist heilig (Jes 6,3). Andererseits werden auch menschlich nachvollziehbare Adjektive verwendet. Gott ist treu (Jes 49,7; 2. Thess 3,3), weise (Hiob 12,13), freundlich (Ps 100,5) und er lügt nicht (4. Mose 23,19).
Als eine herausragende Eigenschaft wird in der gesamten Bibel schließlich Gottes Gerechtigkeit betont. Sein gesamtes Handeln ist gerecht (5. Mose 32,4). Der Glaube an solch einen Gott zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Am Beispiel des Wortes „gerecht“ kann aber auch deutlich werden, wie problematisch die Rede von Gott in einem festlegenden Adjektiv sein kann.
Ist Gott gerecht in dem Sinne, dass alle Menschen in einem vergleichbaren Maß das erhalten, was sie verdienen? Folgt auf bestimmtes Tun eine bestimmte Konsequenz? Werden gute Taten von ihm gewürdigt und schlechte bestraft? Werden gerechte und gottesfürchtige Menschen für ihr Verhalten belohnt? Zahlreiche biblische Texte legen diese Vorstellung nahe. „Siehe, dem Gerechten wird vergolten auf Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder“ (Spr 11,31 Lu)! Gegen solche Aussagen aber stehen die Erlebnisse unzähliger Menschen durch die gesamte Geschichte der Menschheit hindurch. Auch die Bibel selbst thematisiert diese widersprüchlichen Erfahrungen. So klagt Hiob über einen ungerecht strafenden Gott (Hiob 9,22-24). Bis heute steht vielen Menschen die Frage nach dem unerklärlichen Leid in dieser Welt dem Glauben an einen gerechten Gott im Weg. Was folgt nun daraus? Müssen wir die Vorstellung eines gerechten Gottes aufgeben? Oder muss sich unsere Hoffnung auf eine endgültige Gerechtigkeit in eine Zeit nach diesem Leben verschieben?
Es wird deutlich: Eine Wesensbeschreibung Gottes anhand von Eigenschaftsworten mit ganz bestimmten Bedeutungen ist ungenügend. Unser Dilemma bleibt bestehen. Die Suche nach einem passenden Namen für ihn, seine Verortung an einem bestimmten Platz und auch die nähere Bestimmung durch Begriffe ‒ all diese Bestrebungen sind wichtig und trotzdem niemals ganz treffend oder gar ausreichend.
Die Bibel selbst zeigt uns einen Weg, wie wir bloße Merkmale eines überirdischen Wesens hinter uns lassen können, und stellt uns Gott noch einmal anders vor: als eine Person. Die Frage nach dem „Wie?“ wird jetzt also zu einem „Wer?“. In dem Moment, in dem Gott seine Unendlichkeit verlässt und in der Person Jesu sichtbar erscheint, entsteht zum ersten Mal eine Möglichkeit, den Allmächtigen anzufassen. Der Unbeschreibliche kann menschlich erlebt werden. Trotz aller Faszination, trotz allen bleibenden Geheimnisses können Menschen ihn nun selbst fragen, wer er eigentlich sei (Lk 7,19-23). Seit Jesus wird die Frage nach passenden Adjektiven nicht länger nur abstrakt behandelt. Gott ist nicht länger entrückt und nur schemenhaft erkennbar, sondern wird den Menschen zum Freund, Bruder und Vorbild. Menschen können ihn sehen, ihn berühren und sich berühren lassen.
Gott mit Adjektiven zu beschreiben stößt also immer an Grenzen. Sie bleiben zu eindimensional. In Jesus, in seiner Person und seinem Handeln kann Gott dagegen dreidimensional entdeckt werden. Was das bedeuten könnte, lässt sich noch einmal an dem Attribut „gerecht“ skizzieren:
Die Evangelien erzählen uns von Jesus als einem Menschen, der bisherige Vorstellungen von Gerechtigkeit überwindet. Er tritt eben nicht mit einer Waage in der Hand auf, um Menschen zu beurteilen und ihnen dann zu geben, was ihnen zusteht. Sein Interesse gilt nicht den Vorbildlichen, sondern den Verlorenen. Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, Tote und Arme ‒ das sind seine Leute. Leute am Rand und Leute am Ende. Leute, die versagt haben und nach Menschenweise den Tod verdienen: die Ehebrecherin (Joh 8,2-11), der Verbrecher neben Jesus am Kreuz (Lk 23,41-43). Ja, sogar Leute, die ihn ‒ Jesus selbst ‒ hassen und töten: „Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (Lk 23,34 BB)! Kurz: Gott gibt seinen Menschen nicht das, was sie verdienen, sondern das, was sie brauchen: Zuwendung, Rettung, Leben. Das ist die Gerechtigkeit Jesu. Sie ist nicht fair, nicht konsequent, nicht statisch. Sie ist so wenig statisch, wie Liebe statisch sein kann: Die leidenschaftliche und grenzenlose Liebe eines Schöpfers zu seinen Geschöpfen (Joh 3,16). Liebe ‒ das ist das Wort, das den unfassbaren Gott wohl am besten beschreibt.
Читать дальше