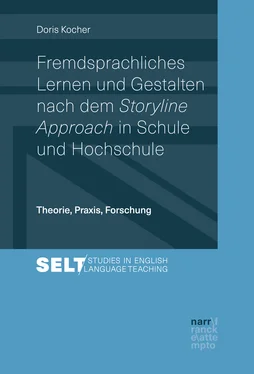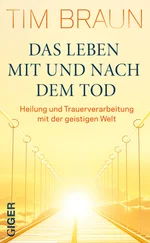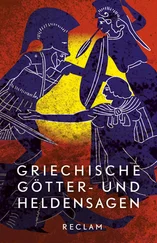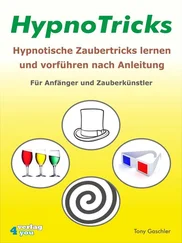4 Grundlagen eines motivierenden Unterrichts
4.1 Einleitung
Lernen muss vom Individuum selbst gewollt werden (Haß 2010, 204)
In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits dargestellt, dass bzw. warum Lernende ihren Unterricht oft langweilig und wenig gewinnbringend empfinden, so dass es nicht verwunderlich ist, wenn in regelmäßigen Abständen durchgeführte und aufwändig konzipierte Studien zu dem Ergebnis kommen, dass die Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern mit zunehmendem Alter abnimmt, obwohl eigentlich genau das Gegenteil der Fall sein sollte: Schule sollte zum lebenslangen und autonomen Lernen anregen! Diese Beobachtung wird zwar offenbar in verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Schulkontexten1 gemacht, betrifft jedoch laut DESI-Studie2 insbesondere auch den Englischunterricht an deutschen Schulen.
Die Frage liegt nahe: „Was ist guter Unterricht?“ (Meyer 2016). Sie lässt sich noch weiterspinnen: Ist guter Unterricht auch zugleich motivierender Unterricht?3 Was ist motivierender Unterricht? Was motiviert Schülerinnen und Schüler? (Wie) kann Motivation gefördert werden? (Wie) können Kinder und Jugendliche zum lebenslangen Lernen motiviert werden? All diesen Fragen wurde bereits in den vorherigen Kapiteln nachgegangen, mit dem Ergebnis, dass Lernumgebungen, die auf der Basis von konstruktivistischen Ansätzen gestaltet sind, die Lernmotivation und zugleich auch das Lernergebnis positiv beeinflussen können. Ob und inwiefern dies auch für Storyline -Projekte im fremdsprachlichen Klassenzimmer der Sekundarstufe I zutrifft, sollen meine Untersuchungen in Teil B zeigen.
Nun sollen die obigen Fragen noch aus einer anderen Perspektive, nämlich aus Sicht der Motivationsforschung, betrachtet werden. Es würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen, in vollem Umfang sowohl Erkenntnisse, Konzepte und Theorien aus der (Pädagogischen) Psychologie als auch die fachspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen, so dass der Fokus hier insbesondere auf die Fremdsprachenforschung gerichtet werden soll.4 Im Anschluss werden einige praktische Empfehlungen für den Fremdsprachenunterricht abgeleitet und anschließend in Zusammenhang mit dem Storyline Approach gebracht. Zunächst aber soll der Begriff „Motivation“ selbst näher untersucht werden.
4.2 Was ist Motivation?
4.2.1 Einleitung
Strictly speaking, there is no such thing as ‘motivation’ (Dörnyei 2001a, 1)
Das Thema „Motivation“ ist in unserem persönlichen und beruflichen Alltag allgegenwärtig, wenn wir uns über Vorlieben, Hobbys, Arbeitsbedingungen oder Lebensplanung austauschen. Im schulischen Bereich allerdings fällt der Begriff oft dann, wenn Lern- und Leistungsprobleme, Schulunlust, Schulversagen, Disziplinprobleme oder andere Missstände begründet werden sollen: Lehrkräfte beklagen sich über demotivierte Schüler und Schülerinnen, die nicht mitarbeiten und stattdessen den Unterricht stören. Lernende dagegen monieren langweilige Materialien und Themen, lasten mangelnde Motivation jedoch in erster Linie dem Lehrerverhalten an (Dörnyei 1998; Kleppin 2001; Solmecke 1983).1 In dieselbe Kerbe schlagen nicht selten auch die Eltern, und manche fragen sich nach dem volkswirtschaftlichen Schaden, der durch demotivierte Lernende angerichtet wird (Leupold 2004).
In der Fachliteratur zum fremdsprachlichen Lernen und Lehren wird Motivation für vieles verantwortlich gemacht: „Sie beeinflusse die Wahl eine bestimmte Fremdsprache zu lernen, den Lernprozess, das Verhalten im und nach dem Unterricht, den Lernerfolg, die Benutzung geeigneter Lernstrategien oder auch die Behaltensleistung“ (Kleppin 2001, 219). Doch auch wenn der Begriff in aller Munde ist, scheint es schwierig, eine Definition zu finden, die diesen Terminus umfänglich erklärt und zugleich präzisiert. Dörnyei, der auf dem Gebiet Motivation im Fremdsprachenunterricht heute sicher zu den bedeutendsten Forschern und Autoren zählt, versucht durch das eingangs aufgeführte Zitat zu verdeutlichen, dass „Motivation“ nicht nur ein vager, sondern zugleich auch ein weiter Begriff ist, welcher ganz verschiedene Bedeutungen abdeckt. Es liegt folglich auf der Hand, dass der Begriff eine Vielzahl von Motiven subsumiert, deren gemeinsamer Nenner allein die Tatsache ist, dass sie alle in irgendeiner Weise Einfluss auf das Verhalten nehmen.
Bereits seit Platon und Aristoteles spricht man laut Heckhausen (2006) von einer „Trias der psychologischen Sachverhalte“ (Ebd., 14) und unterscheidet als Entitäten des Seelenlebens Kognition (Erkennen), Emotion (Fühlen) und Motivation (Wollen). Dörnyei (2001a) betrachtet Motivation als einen der grundlegendsten Aspekte des menschlichen Geistes, welcher offenbar auch in hohem Maße mit darüber entscheidet, ob Lernsituationen erfolgreich verlaufen oder nicht. Auf das fremdsprachliche Lernen bezogen vertritt er die Meinung, dass 99 % der Lernenden, die eine Fremdsprache lernen wollen und auch wirklich motiviert sind, es am Ende tatsächlich schaffen können, “to master a reasonable working knowledge of it as a minimum, regardless of their language aptitude. (...) Without sufficient motivation, however, even the brightest learners are unlikely to persist long enough to attain any really useful language“ (Ebd., 2-5). Nachfolgend wird der Begriff „Motivation“ genauer untersucht, bevor einige Probleme hinsichtlich der Theoriebildung sowie neue Impulse aus der Motivationsforschung dargestellt werden.
Der Begriff „Motivation“ leitet sich von dem lateinischen Verb movere (bewegen) ab. Motivation ist somit etwas, das uns bewegt und antreibt, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Man kann Motivation als solche bei anderen Personen nie direkt sehen oder als Gegenstand wahrnehmen; sie lässt sich nur „anhand von Indikatoren im Verhalten, Denken und emotionalen Erleben erschließen“ (Dresel/Lämmle 2011, 81). Motivation gilt somit als „gedankliche Konstruktion“ (Rheinberg 2006b, 14). bzw. als ein „kognitives Kunstprodukt“ (Ebd.), um bestimmte Verhaltensbesonderheiten zu erklären. Dennoch ist uns der Zustand des Motiviertseins mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Abstufungen aus dem Selbsterleben oder durch Verhaltensbeobachtung bekannt. Rheinberg (2006b) spricht von insgesamt drei Dimensionen, die den Begriff „Motivation“ charakterisieren: „Es geht (...) darum, daß jemand (1) ein Ziel hat, daß er (2) sich anstrengt und daß er (3) ablenkungsfrei bei der Sache bleibt“ (Ebd., 14). Die meisten in der Fachliteratur aufgeführten Definitionen enthalten die folgenden drei Komponenten von Motivation: Aktivierung ( arousal ), Richtung ( direction ) und Ausdauer ( persistence ) eines zielgerichteten Verhaltens.
Williams und Burden (1997), die im Bereich des Fremdsprachenlernens eine sozial-konstruktivistische Perspektive vertreten, heben unter anderem das Zusammenwirken kognitiver und emotionaler Komponenten hervor und definieren Motivation wie folgt:
Motivation may be construed as
a state of cognitive and emotional arousal,
which leads to a conscious decision to act, and
which gives rise to a period of sustained intellectual and/or physical effort
in order to attain a previously set goal (or goals) (Ebd., 120).
Dörnyei und Ottó, ebenfalls Vertreter aus der Fremdsprachenforschung, betonen in ihrer Definition insbesondere den Prozesscharakter von Motivation:
In a general sense, motivation can be defined as the dynamically changing cumulative arousal in a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates the cognitive and motor processes whereby initial wishes and desires are selected, prioritised, operationalised and (successfully or unsuccessfully) acted out (Dörnyei/Ottó 1998, 65).
Читать дальше