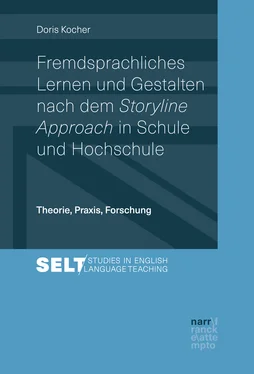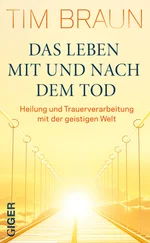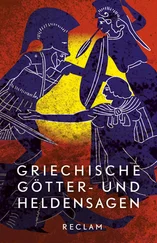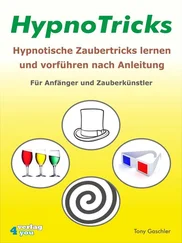Dass sich Investitionen lohnen, wurde mittlerweile erkannt, denn durch diverse Sonderprogramme „sind die Bildungsausgaben überproportional gestiegen“ (ABB, Hrsg. 2012, 6). Im Jahr 2010 wurden insgesamt 172,3 Milliarden Euro für Bildung ausgegeben: „der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm – bei einem um 3,9 gestiegenen BIP – von 6,9 auf 7 % zu“ (Ebd.). Ob das Bildungsbudget in den letzten Jahren tatsächlich stark gestiegen ist, lässt sich schwer einschätzen, denn auch im 5. Bildungsbericht wurde für 2012 zwar eine „weitere Steigerung der Bildungsausgaben“ dokumentiert, allerdings (erneut) mit dem Hinweis: „aber Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) leicht rückläufig“ (ABB, Hrsg. 2014, 5).
Die PISA-Befunde aus den Jahren 2000 (PISA, Hrsg. 2001), 2003 (PISA, Hrsg. 2004) und auch 2006 (PISA, Hrsg. 2007), auf die ich im Einzelnen nicht näher eingehen kann, bestätigten im Grunde genommen das, was schon durch zahlreiche frühere Untersuchungen3 in Deutschland belegt und beklagt worden ist, nämlich einen großen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft bzw. Bildungsnähe des Elternhauses und schulischer Leistungsfähigkeit der Kinder. Sie zeigten deutlich, „dass das deutsche Schulwesen in besonderer Weise sozial selektiv wirkt und somit nicht nur die Begabungsreserven einer Gesellschaft nur unzureichend ausgeschöpft werden, sondern zudem soziale Ungerechtigkeit produziert wird“ (Frederking u.a. 2005, 7). Diese Feststellung war im Prinzip nichts Neues, doch „PISA machte die Misere zum Medienereignis“ (Kluge 2003, 74) und zeigte die Wirkung eines mittleren Erdbebens.4
Oft wurde in diesem Zusammenhang kritisiert, dass die multikulturelle Randgruppe für den Gesichtsverlust Deutschlands verantwortlich sei. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um eine sehr verengte Sichtweise: „Das deutsche PISA-Leistungsdefizit ist sicherlich zu einem Teil ein Migrantenproblem. Aber es sind weniger der Migrantenstatus als solcher, sondern eher die verwendete Sprache und die Sprachkompetenz, welche sich auf die Leistungen auswirken“ (Sacher 2005, 49).5 Eine schlechte sprachliche und kommunikative Kompetenz wirkt sich natürlich auch auf die Leistungen in den Sachfächern aus, wo vermehrt divergentes Denken oder Problemlösestrategien zum Einsatz kommen, denn jedes Lernen und jede Wissenskonstruktion ist bekanntlich (auch) sprachbasiert.
Verleugnet werden darf hier jedoch nicht, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Grund der äußerst schlechten Leseleistungen auch im Jahr 2003 (PISA II) als „Risikogruppe“ (Pommerin-Götze 2005, 144) eingestuft wurden, was nicht nur deren Bildungschancen, sondern auch deren Ausbildungs- und Berufschancen verringert und auch hinsichtlich einer Integration in die Gesellschaft nicht förderlich ist (PISA, Hrsg. 2004, 265). Dies wird auch im Bildungsbericht 2008 bestätigt: „Migrationshintergrund führt in allen Stufen des Bildungssystems zu Benachteiligungen“ (ABB, Hrsg. 2008, 17). Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erhalten seltener eine Empfehlung für Realschule oder Gymnasium, und „gelangen sie auf höhere Schulen, haben sie größere Schwierigkeiten, sich dort zu halten“ (Stein/Stummbaum 2011, 207). Sie besuchen nicht nur seltener ein Gymnasium oder eine Hochschule, sondern verlassen auch doppelt so häufig die Schule, „ohne zumindest den Hauptschulabschluss zu erreichen“ (ABB, Hrsg. 2008, 17). Während die Bildungsbeteiligung in Deutschland kontinuierlich gestiegen ist, stagniert sie bei Personen mit Migrationshintergrund (Stein/Stummbaum 2011, 207).
Auch der Bildungsbericht 2012 attestiert, dass über 19 % der 15-Jährigen nicht richtig lesen und Texte verstehen können. Jugendliche mit Migrationshintergrund und diejenigen mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status sind dabei „überdurchschnittlich häufig vertreten“ (ABB, Hrsg. 2012, 9). Eine frühe Sprachförderung für Kinder mit nicht deutscher Familiensprache wird deshalb noch immer dringend empfohlen (Ebd.; Stein/Stummbaum 2011, 216).6 Im Übrigen hat die DESI-Studie7 (DESI-Konsortium, Hrsg. 2008; nachfolgend: DESI) gezeigt, dass auch die Lesekompetenz im Fremdsprachenunterricht gefördert werden muss (Eisenmann 2012, 90).
Die „Ausschöpfung der Begabungsreserven“ (Altrichter/Hauser 2007, 5) scheint heute wieder eine Renaissance zu erleben, aber nicht allein aus ethischen, moralischen oder sozialen Gründen, sondern schlicht und ergreifend aus demographischen und den damit verbundenen finanziellen Sorgen, denn es geht um die Sicherung der zukünftigen Rentenzahlungen und unseren Wohlstand, die im Zuge des globalisierten Wettbewerbs und der schrumpfenden Schülerpopulation gefährdet sind. Ähnliche Befürchtungen hatte man übrigens bereits Mitte des letzten Jahrhunderts. Der „PISA-Schock“ kann quasi als Nachfolger des früheren „Sputnik-Schocks“ betrachtet werden, denn in der unmittelbaren Nachkriegszeit und in den 1950er Jahren war offensichtlich geworden, dass die Bildungsbeteiligung in Deutschland stark an die soziale Herkunft gebunden ist. Dieser Befund führte damals zu diversen Reformmaßnahmen und setzte unter anderem eine breit angelegte Bildungsexpansion in Bewegung, um eine angeblich drohende „Bildungskatastrophe“ (Picht 1964) aufzuhalten sowie wirtschaftliche und politische Nachteile zu vermeiden. Geißler (1994) beschreibt zwei Paradoxe der damals initiierten Bildungsexpansion: nämlich die Aufwertung ( Upgrading ) und gleichzeitige Entwertung (Inflationierung) der Bildungsabschlüsse, was beim Wettbewerb um Arbeitsplätze und damit verbundene Lebenschancen eine „vertikale Verdrängung“ (Geißler 2011, 281, im Original Fettdruck) zur Folge hatte. Die Bildungsexpansion verbesserte zwar im Sinne der „Umschichtung nach oben“ (Ebd., 278, im Original Fettdruck) die Bildungschancen insgesamt, verstärkte aber gleichzeitig die soziale Ungleichheit auf dem Weg zu höheren Bildungsniveaus.8
Der damals ersehnte „Fahrstuhl-Effekt“ ist also ausgeblieben, stattdessen ist die Konkurrenz um Lebenschancen über Bildungsabschlüsse für viele wesentlich länger und anstrengender geworden. Die letzten Shell Jugendstudien haben gezeigt, dass es bis heute nicht gelungen ist, „soziale Ungleichheit beruhend auf der Herkunft der Jugendlichen über die Schule auszugleichen. Vielmehr zementiert Schule mit ihrer Funktion der Zuweisung von Bildungskarrieren solche sozialen Unterschiede“ (Shell Deutschland Holding, Hrsg. 2010, 80; nachfolgend: Shell). Fest steht: Für den Statuserhalt kann der erworbene Bildungstitel nur „durch die Bereitschaft zum ‘Lebenslangen Lernen’ in seinem Wert erhalten werden“ (Ebd., 2010, 71).
Erfreulicherweise profitieren von der Bildungsexpansion insbesondere immer mehr Mädchen und junge Frauen, die zumindest im Bereich der Schulbildung die Jungen sogar überholt haben.9 Allerdings ist dieser Bildungsaufstieg „keine Garantie für ein Aufholen von Frauen im späteren Berufsleben“ (Shell, Hrsg. 2006, 68), denn nach wie vor existieren bei der Wahl von Studienfächern oder Ausbildungsberufen die altbekannten Rollenmuster und auch hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen existieren „erhebliche Unterschiede“ (ABB, Hrsg. 2008, 17): Frauen sind zwar immer häufiger erwerbstätig, allerdings wegen der Kindererziehung vielfach nur in Teilzeit (ABB, Hrsg. 2012, 5). Außerdem werden Frauen trotz gleicher Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt noch immer „deutlich niedriger als Männer bezahlt“ (Shell, Hrsg. 2010, 74). Daran hat sich bis heute nichts geändert!
Soziale Disparitäten im deutschen Bildungssystem entstehen primär bei den Übergangsentscheidungen von der Grundschule in die Sekundarstufe (Baumert/Köller 2005; Shell, Hrsg. 2010; 2015). Trotz vielfältiger Bemühungen in den vergangenen Jahren bestätigen diverse Studien, dass „in Deutschland die Koppelung zwischen sozialer Herkunft und Kompetenz [noch immer] zu stark“ ist (PISA, Hrsg. 2007, 30) und dass diese hierzulande „nach wie vor stärker ausgeprägt ist als in anderen Staaten“ (ABB, Hrsg. 2008, 15). In der 16. Shell Jugendstudie wurde belegt, dass Deutschland unter den OECD-Ländern das Land ist, „in dem der schulische Erfolg am stärksten vom sozialen Status der Eltern abhängt“ (Shell, Hrsg. 2010, 72). Im Bildungsbericht 2014 wird moniert, dass „trotz leichter Verbesserung (...) weiterhin eine starke soziale Ungleichheit bei der Bildungsbeteiligung bestehen [bleibt]“ (ABB, Hrsg. 2014, 6). Dies wird auch in der 17. Shell Jugendstudie bestätigt (Shell, Hrsg. 2015, 66ff.). Von einer Chancengleichheit sind wir also noch weit entfernt. Darüber hinaus wird das kognitive und motivationale Potenzial der Lernenden bedauerlicherweise „nur unzureichend ausgeschöpft“ (Stein/Stummbaum 2011, 209).
Читать дальше