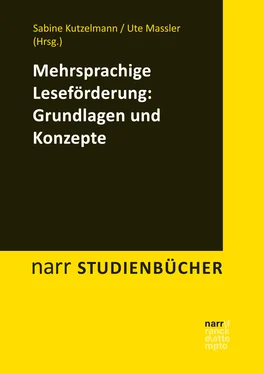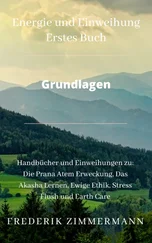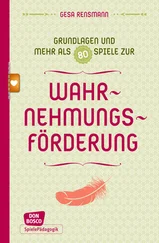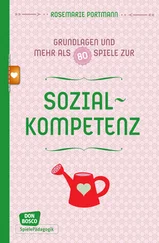Ähnlich, aber deutlich schwächer waren die positiven Wirkungen der Lautlesetandems auf Flüssigkeit und Textverstehen bei den Grundschulkindern. Auch hier ließ sich das Verfahren problemlos in den Unterricht implementieren. Es gab allerdings auf der Prozessebene des Lesens Deckeneffekte, was heißt: Viele der Kinder lasen die von uns zusammengestellten Texte ohnehin flüssig, sodass keine weiteren Zugewinne bei der Flüssigkeit erzielt werden konnten. Sie beurteilten das Training in der Nachbefragung entsprechend eher als langweilig. Allerdings gab es auch eine große Gruppe innerhalb der Grundschüler/innen, die die Texte als zu schwierig wahrgenommen hat und für die das Tandem-Lesen laut Selbstauskünften zu anspruchsvoll war (Lauer-Schmalz/Rosebrock/Gold 2014, Gold/Rosebrock 2017).
Auch von den Vielleseverfahren waren die Lehrkräfte und die Schülerschaft in der Hauptschul-Studie durchaus begeistert – allerdings: Wenn interessierte Fremde große Kisten mit Buchgeschenken bringen und die Klasse ein Halbjahr lang mit Tests und Unterrichtsbeobachtungen begleiten, liegt Begeisterung unabhängig von der Qualität der Förderung nahe. Und doch zeigten die stillen Lesezeiten keine signifikant werdenden Wirkungen im Vergleich zur Kontrollgruppe: Die Leseflüssigkeit hat sich nicht bedeutend verbessert, und auch das Textverstehen hat nicht profitiert. Am Rande sei hier eine Beobachtung angefügt, die sich wegen der zu kleinen Anzahl an Klassen in unserer Studie nicht empirisch belegen lässt: Die (zu wenigen) Klassen in eher ländlichem Umfeld zeigten Verbesserungen in beiden Dimensionen, Flüssigkeit und Textverstehen, durch die Vielleseverfahren; sie wurden durch die weniger erfolgreichen Klassen im städtischen Umfeld gewissermaßen neutralisiert. Auch Manning, Lewis und Lewis (2010) weisen für den amerikanischen Raum moderate Fördererfolge bei stillen Lesezeiten nach. Nicht verschwiegen werden soll allerdings, dass zahlreiche Us-amerikanische Studien keine Erfolge bei Vielleseverfahren in unterschiedlichen Varianten nachweisen konnten (NICHD 2000).
Wie lässt sich der fehlende Erfolg der Vielleseverfahren für Leseflüssigkeit und Textverstehen erklären? Oben wurde bereits die Vermutung formuliert, dass Vielleseverfahren in der Tendenz zu anspruchsvoll für solche Leser/innen sein könnten, die Probleme bei der Flüssigkeit haben. Denn sie verlangen über die Wort- und Satzerkennung hinaus eine ganze Anzahl weiterer Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen von Lesekompetenz. In diesem Zusammenhang ist eine US-amerikanische Studie aufschlussreich (Kelley/Clausen-Grace 2010; vgl. auch Rieckmann 2015): In ihr wurde das sichtbare Verhalten von Schüler/innen beim sustained silent reading , bei Vielleseverfahren, über einen längeren Zeitraum beobachtet und anschließend in acht Typen unterteilt. Die Spitzengruppen innerhalb der acht Typen interessieren in unserem Zusammenhang weniger und seien doch kurz erwähnt: Das sind z.B. die sogenannten „Bücherwürmer“, die auch bei konkurrierenden Beschäftigungsangeboten weiterlesen, oder die „Genre-Leser“, die begeistert solche Serienliteratur lesen, von der sie schon Exemplare kennen. Am schwachen Ende der Typen-Skala modellierten die Autorinnen den Typ des „Fake-Readers“. Diese „Als-ob-Leser“ umgehen faktisch das Lesen – sie lassen z.B. den Blick über die Seiten schweifen oder blättern nach Bildern, und sie finden zahlreiche alternative Handlungen (Hände waschen gehen, Bleistift spitzen, Mäppchen verstauen …), um das Lesen zu vermeiden. Vielleseverfahren laufen bei ihnen offensichtlich ins Leere, denn sie lassen sich auf eigenständige Lektüre nicht ein. Von besonderem Interesse im vorliegenden Kontext ist der Typ des „Überforderten Lesers“ ebenfalls am unteren Ende der Skala. Dieser Typ ist im Grunde engagiert, aber er hat aufgrund zahlreicher einschlägiger Misserfolgserfahrungen innerlich weitgehend aufgegeben. Die Lektüre bricht immer wieder ab. Diesem Typ „Überforderter Leser“ lassen sich besonders viele mehrsprachige Schüler/innen zuordnen, aber auch solche aus wenig unterstützenden familiären Kontexten oder mit kognitiven Beeinträchtigungen. Dieser Typ braucht eine genaue Passung der Lesematerialien zu seinen Fähigkeiten, so Kelley und Clausen, um endlich Erfolgserfahrungen bei der Lektüre zu erleben. Wenn diese Kinder die gleichen Texte wie die guten Leser/innen bekommen, haben sie kaum eine Chance, in die Texte hineinzufinden. Didaktisch interessant an der Studie ist auch die schlichte Methodologie, die sich für die Erforschung stiller Lesezeiten hierzulande und für die Diagnose im Klassenzimmer übernehmen lässt: Anhand des äußerlich sichtbaren Verhaltens wurde das Lesen kategorisiert und konnte relativ trennscharf typisiert werden (vgl. auch Hiebert/Wilson/Trainin 2010).
Die Hoffnung, dass die Vielleseverfahren die Motivation steigern könnten, hat sich in unserer Hauptschulstudie nicht verwirklicht: Sowohl die Lautlese- als auch die Viellesegruppen konnten hier keine signifikanten Steigerungen erzielen, und auch zwischen den Geschlechtern konnten wir keine bedeutsam werdende Differenz finden. In einer weiteren Studie haben wir versucht, dem freien Lesen in einer Hauptschulklasse die systematische Unterstützung und relativ kleinschrittige Kontrolle zukommen zu lassen, von der wir vermuten, dass sie ursächlich am Erfolg der Lautleseverfahren beteiligt sind. Auch diese Studie zum eigenständigen Lesen ist publiziert und soll hier nur erwähnt werden (vgl. Rieckmann 2015; Jörgens/Rosebrock 2011; Rieckmann/Jörgens/Rosebrock 2013). Abgesehen davon, dass eine intensive Unterstützung des freien Lesens nur kleine Fallzahlen zulässt und insofern nur heuristische Ergebnisse liefern kann, ist das gravierendste Problem der Begleit- und Unterstützungsroutinen, dass sie von einer Lehrkraft für etwa 15 leseschwache Kinder nicht geleistet werden kann. Die Implementierbarkeit in das gegenwärtige Schulsystem ist also nicht gegeben.
5. Mehrsprachige Kinder innerhalb der Gruppe schwacher Leser/innen
In der Stichprobe der leseschwachen 12- bis13-jährigen Hauptschüler/innen, die oben knapp beschrieben wurde, berichteten, wie gesagt, 63 % der Kinder, dass sie zu Hause ausschließlich oder zusätzlich eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Diese mehrsprachigen Kinder zeigen in unserem Motivations-Fragebogen, für den wir den Motivation for Reading Questionnaire (Wigfield/Guthrie 1997) leicht modifiziert hatten, eine etwas stärkere Lesemotivation als ihre einsprachigen Klassenkamerad/innen; zugleich ist ihr lesebezogenes Selbstkonzept etwas deutlicher ausgeprägt. Diese beiden Komponenten von Lesekompetenz schlagen sich allerdings nicht in ihren getesteten Leseleistungen nieder. Sie verstehen Texte trotz dieser beiden positiven Faktoren etwas schlechter als die monolingual deutschsprachigen Kinder – wobei, wie gesagt, alle Kinder der Stichprobe in ihrer Leseleistung etwa eine Standardabweichung unter Normal lagen. Die deutschsprachigen zeigen dagegen etwas bessere Ergebnisse im Wortschatztest und in den nonverbal erhobenen kognitiven Grundfähigkeiten, und sie berichten von besseren Voraussetzungen in ihrer Lesesozialisation. Die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit war bei beiden Gruppen gleich (schwach) ausgeprägt (Gold/Nix/Rieckmann/Rosebrock 2010).
Die beiden prozessnahen Variablen Leseflüssigkeit und (mit Abstand) Wortschatz haben sowohl bei den mehrsprachigen als auch bei den einsprachigen Kindern den größten Einfluss auf das Textverstehen. In beiden Gruppen ist die Leseflüssigkeit der bei weitem wichtigste Prädiktor zur Vorhersage des Textverstehens. Eine kleine Differenz ergab sich beim Einflussgewicht dieses Prädiktors: Bei den mehrsprachigen Kindern hat die Leseflüssigkeit (mit einem standardisierten Reggressionskoeffizienten von β = .54.) ein noch größeres Gewicht für das Textverstehen als bei den einsprachigen (β = .48, beide p <.01). Für beide Teilstichproben gilt: Die soziokulturellen und motivationalen Bedingungsfaktoren, durch die sich schlechte Leser/innen der Stichprobe von besseren unter anderem unterscheiden, fallen bei gleicher Flüssigkeit nicht mehr ins Gewicht; auch gibt es keine Wechselwirkung mit Geschlechtszugehörigkeit und Intelligenz und mit dem Erfolg der Lautleseverfahren (a.a.O.).
Читать дальше