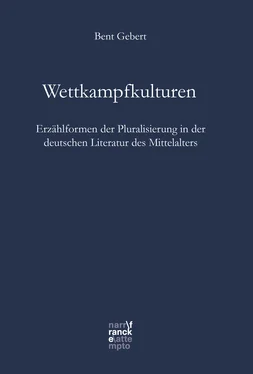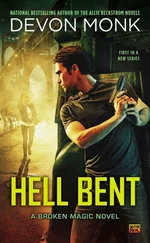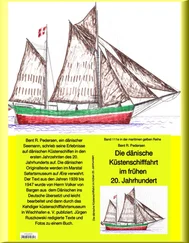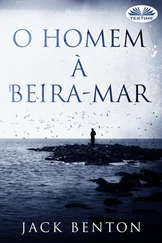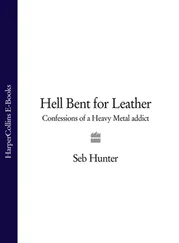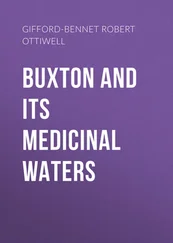In anderen Gattungszusammenhängen haben Beate Kellner und Peter Strohschneider umrissen, wie eine solche Theorie ansetzen könnte.48 Ihr Vorschlag setzt bei der agonalen Kommunikation der Sangspruchdichtung an:49 So profiliere sich der Anspruch auf Meisterschaft in der paradoxen Spannung, dass Konkurrenten durch poetisch exponiertes Wissen einerseits zum Verstummen gebracht werden sollen, andererseits aber immer wieder zu Wort kommen müssen, um Bestätigung, Anerkennung und Fortsetzbarkeit von Kommunikation zu garantieren. Diese Wettkampfspannung reflektiert nicht nur die Poetologie des spätmittelalterlichen Meistersangs, der seine komplexer werdenden Liedformen mit agonaler Terminologie belegt.50 Von diesem Kommunikationsparadox her erschließen sich darüber hinaus auch komplexe Redestrategien, die Wissen und Poetik, Reden und Schweigen fortgesetzt potenzieren. Wie diese Spannung von ›Proliferation‹ und ›Destruktion‹ unmittelbar textgenerierend wirkt, belegen die umfang- und variantenreichen Arrangements des Wartburgkriegs . Nicht nur für den Bereich der Spruchdichtung ist dies einschlägig: Viele Wettkampfmuster basieren auf einfachen Formen, die Entfaltungs- und Verwicklungsmöglichkeiten sowohl anstoßen als auch begrenzen. Für eine Theorie von Wettkampfformen, die auch für Erzähltexte fruchtbar zu machen ist, liefert dieses Spannungsverhältnis einen wichtigen Fingerzeig.
Wie weit eine solche Theorie in kulturgeschichtlicher Hinsicht ausholen müsste und auf welche Gegenstandsfelder sie sich erstrecken könnte, ist hingegen eine offenere Frage. Die bisherigen Antworten der Mediävistik weisen in unterschiedlichste Richtungen, von Analysen spezifischer Felder bis zu Agonalitätskonzepten mit globalen Erklärungsansprüchen. Verdanken sich Wettkampfformen in erster Linie innerliterarischer Motivbildung,51 ästhetischer Muster52 oder speziellen Gattungskonventionen? Verweisen dialektische Zuspitzungen und Oppositionsstrukturen53 in literarischen Texte des hohen Mittelalters auf spezifische Erfahrungs- und Repräsentationsmuster besonderer Milieus wie etwa der ›höfischen Kultur‹ des Adels?54 Oder sollten wir Wettkampftexte eher als Produkte eines übergreifenden »mental habit of the Middle Ages« betrachten,55 einer allgemeinen »Neigung des Mittelalters« zu Kontrast, Konflikt und Streit?56 Kommt in ihnen gar eine »fundamentale Agonalität« zum Ausdruck, die für orale Gesellschaften überhaupt – und damit weit über das Mittelalter hinaus – charakteristisch ist?57 Zwischen solchen enger bzw. weiter gesteckten Prämissen äußern sich Stimmen, die literarische Wettkämpfe als historische ›Geschmacksvorlieben‹58 oder ›Moden‹59 bezeichnen. Will man sich nicht mit vagen Einschätzungen begnügen, so birgt die literaturwissenschaftliche Forschung also eine doppelte Gefahr: Wettkämpfe entweder zu eng zu fassen (z.B. als höfisches Interaktionsmuster) oder aber zu entgrenzen (z.B. in Richtung epochaler Muster).
3.2 Grundlagen der Konfliktsoziologie
Entkommt man dieser Schwierigkeit, wenn man sich einfach an Grundlagentheorien der Streit- und Konfliktsoziologie hält? Einige der angesprochenen Theorieprobleme – besonders im Blick auf die paradoxe Dynamik von Wettkämpfen – finden sich bereits in klassischen Positionen angelegt. So registriert etwa Georg Simmel1 äußerst feinfühlig, welche Spannungen Vergesellschaftungsprozesse des Streits begleiten. Doch ebenso deutlich zeigen sich die Schwierigkeiten, wie konvergierende und divergierende Bewegungen als Einheit zu fassen seien. Simmel sichtet dieses Problem an einem schillernden Spektrum von Kampfformen der unterschiedlichsten ›sozialen Kreise‹: von Rechtsstreitigkeiten und alltäglichen Aggressionen im Stadtleben bis zur Eifersucht von Ehepartnern, vom Kriegsverhalten der Indianer bis zu Disputen der Wissenschaft, von Rivalitäten unter mittelalterlichen Adelshöfen, Katholiken und Protestanten oder unter Künstlern bis zum biologischen Daseinskampf. Alle diese Fälle verbinde Nähe und Widerstreben, wie Simmel am Beispiel von Konkurrenten erläutert:
Man pflegt von der Konkurrenz ihre vergiftenden, zersprengenden, zerstörenden Wirkungen hervorzuheben und im übrigen nur jene inhaltlichen Werte als ihre Produkte anzugeben. Daneben aber steht doch diese ungeheure vergesellschaftende Wirkung: sie zwingt den Bewerber, der einen Mitbewerber neben sich hat und häufig erst hierdurch eigentlicher Bewerber wird, dem Umworbenen entgegen- und nahezukommen, sich ihm zu verbinden, seine Schwächen und Stärken zu erkunden und sich ihnen anzupassen […]. (S. 327)
Nicht nur triadische Relationen der Konkurrenz setzten solche Nähe voraus, im »Verweben von tausend soziologischen Fäden durch die Konzentrierung des Bewußtseins auf das Wollen und Fühlen und Denken der Mitmenschen« (S. 328). Ganz allgemein müssten jegliche »Gegner ein Gemeinsames haben, über dem sich erst ihr Kampf erhebt« (S. 310): »beiderseitige Anerkennung« der Akteure über gemeinsame Objekte des Begehrens (S. 306), institutionalisierte Streitordnungen und der »Zusammenschluß« (S. 360; 354–368) von disparaten Elementen zu Interessenseiten, Gruppen oder Parteien kennzeichneten jegliche Formen und Sphären des Streits. In strukturellem Sinne sieht Simmel darin »ein Gegeneinander, das mit dem Füreinander unter einen höheren Begriff gehört« (S. 284). Kampf tritt damit als paradoxe Beziehung hervor, die sich unter verschiedenen Aspekten näher bestimmen lässt, u.a.
als zirkulär gebaute, exzessive Dynamik;2
als »Verweben«, das innerhalb wie auch zwischen Streitenden Komplexität aufbaut (S. 328);
als Möglichkeit, Differenz zusammenzuführen und Intensitäten zu verstärken (S. 327, 329);
als Risiko, Relationen und Positionen sowohl zu fördern (S. 325) als auch zu zerstören (S. 289).
Für eine formale Beschreibung von Wettkämpfen liefert Simmel damit wichtige Gesichtspunkte. Ebenso grundlegend ist der Hinweis, dass Streit nicht bloß durch Außenabgrenzung die sozialen Relationen einer Gruppe verstärkt, sondern auch deren Binnenkohärenz durch interne Differenzen erhöht. Für den Zusammenhang von Wettkampf- und Kulturformen ist dies von systematischer Bedeutung, insofern Streit damit als paradoxes Muster der Komplexitätsbildung lesbar wird.3
Trotz ausdrücklicher Neigungen zum Paradoxen,4 trotz deskriptiver Sensibilität: Ebenso deutlich zeichnen sich aber Simmels Schwierigkeiten ab, die paradoxe Form des Streits »unter einen höheren Begriff« zu bringen. Mal bleiben seine suchenden Formulierungen vage (z.B. S. 284: »um zu irgend einer Art von Einheit […] zu gelangen«), dann greifen sie umso entschiedener zu metaphysischen Einheitskonzepten: »streitmäßig[e] Beziehungen« sieht Simmel demgemäß auf das Gesamt einer »Lebenseinheit« rückbezogen, deren »Verbindungen« – »unserem Verstande ungreifbar« – eine »mystische Einheit« bildeten (S. 291). Am häufigsten greift Simmel jedoch zum psychologischen Vokabular der Empfindungen, um paradoxe Zumutungen annehmbar zu formulieren: Verbindende und zerstörende Wirkungen des Kampfes mündeten in ein »Mischgefühl« (S. 293), das »Feinfühligkeit« erhöht (S. 328); auf Basis solcher Gefühle kämen Gruppen im Streit überein, ohne ihre Verbindung explizieren zu müssen (S. 310: »geheimes Sich-Verstehen der Parteien« im »stillschweigenden Pakt«). Umgekehrt zeigt Simmels Exkurs über die Regulierung von ökonomischer Konkurrenz, wie paradoxe Aspekte kategorisch unterbunden werden: Wie es das Leitbild des »›ehrlichen‹ Wettbewerb[s]« vorgebe, sei nur »lautere«, »rein[e]« Konkurrenz in vollem Sinne nützlich, die auf alle »irreleitenden« oder bloß schädigende Handlungen verzichte (S. 346f.). Destruktive Tendenzen, die sich aus der Nähe von Konkurrenzbeziehungen entspinnen können, grenzt Simmel somit aus. Aus paradoxen Dynamiken werden idealisierte Dichotomien von reiner und unlauterer Konkurrenz, von direktem und indirektem Streit.
Читать дальше