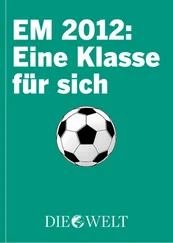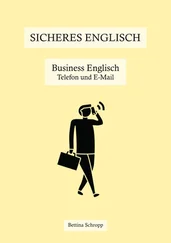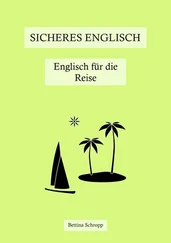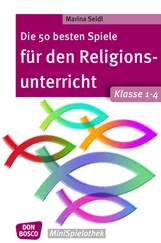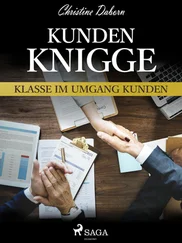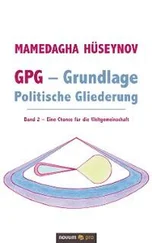Die Unsicherheit der beteiligten Lehrkräfte spiegelte sich vor allem zu Beginn des PROJEKTS in Interviewdaten wieder:
Stimme 1 1 ,2
Gaby: Was könnte ich noch hinzufügen?
Forscherin: Haha
Gaby: ((Spricht mit Akzent)) @Etwas, das bedeutsam ist (.) du weißt schon, was man auch gut zitieren kann@
Forscherin: Haha
Gaby: @ Was ist dann nicht – nee. Nee, nur ein Scherz (.) Etwas das, das humanistischen Wert hat, das humanistisch ist, also, Kindern lernen folglich etwas für ihr ganzen Leben.@
Forscherin: Haha
Gaby: Im Prinzip habe ich das schon gesagt, und und ehm und @sehr verantwortungsvolles, verantwortungsvolles Fach, weil man kann da sehr viel kaput machen, wenn man nicht Spaß rüberbringt, nee@ Das ist ein Scherz. Nee, also, I habe das [Fach] eigentlich mit Absicht gewählt.
Ähnliche Äußerungen finden sich bei anderen Lehrkräften. Für manche Lehrer*innen dauerte es fast 5 Jahre, bis sie sich sicher fühlten, nicht nur selbstbewusst die eigenen Ideen zu vertreten, sondern an einer gemeinsamen öffentlichen Schlusspräsentation mitzuwirken und an einer Abschlusspublikation mitzuwirken (Dreßler et al. 2016).
2.2.3 Die Wertschätzung der alltäglichen pädagogischen Praxis und die Suche nach Schätzen
Selbstvertrauen in die eigene Professionalität hängt nicht zuletzt davon ab, welche Wertschätzung Lehrer*innen ihrer alltäglichen Praxis zukommen lassen und welche sie von anderen erfahren. Von Anfang an dienten die monatlichen Treffen der PROJEKT-Gruppe deshalb dazu, Aspekte der Alltagspraxis unter unterschiedlichen Perspektiven zum Gegenstand des kollegialen Austausches zu machen, mit dem Ziel, solche Wertschätzung zu befördern und zu praktizieren (vgl. Allwright 2003). Orientierung bot Goffmans Konzept der Erfahrungsschemata, das davon ausgeht, dass eine alltägliche Situation, current situation (Goffman 1974: 9) im Diskurs unterschiedlich definiert und interpretiert wird. Diese unterschiedlichen Interpretationen galt es zugänglich und besprechbar zu machen. Ausgangspunkt war die Suche nach „Schätzen“ in der eigenen Praxis. Lehrer*innen wurden gebeten, einen oder mehrere solcher Schätze mitzubringen, zu erklären, warum es sich um einen Schatz handelt und warum sie glauben, dass die Beschäftigung mit ihm das Wissen der Gruppe zum frühen Englischunterricht erweitern könnte. Die Besprechung der Schätze in Kleingruppen und im Plenum zu Beginn der Projektarbeit bot nicht nur die Möglichkeit, individuelle Vorstelllungen zum kommunikativen Englischunterricht zu thematisieren, sondern auch Perspektiven für die Weiterarbeit zu entwickeln. So kristallisierte sich schon früh die systematische Beschäftigung mit Lernaufgaben als Arbeitsschwerpunkt heraus, denn manche der Schätze konnten als Beispiele komplexer Lernaufgaben (Legutke / Thomas 1999, Hallet 2011) gelten, auch wenn die Lehrer*innen sie nicht so bezeichneten.
Die alltägliche Praxis erfuhr ferner eine deutliche Aufwertung durch eine Intensivierung von Unterrichtsbeobachtungen. Sie erfolgten grundsätzlich nur auf Einladung der Lehrer*innen und schlossen die Beobachtungen durch Peers ein. Beobachtungen waren zunächst eher sporadisch und weniger fokussiert. Je deutlicher sich allerdings konkrete Fragen ergaben, etwa wie Schreib- und Leseaufgaben anzuleiten, wie Präsentationsaufgaben zu orchestrieren oder wie Rückmeldungen zu geben waren, nahmen die Beobachtungen und anschließenden Gespräche an Häufigkeit und Intensität zu.
Unterrichtsbeobachtungen und später im PROJEKT auch videografierte Sequenzen, die die Lehrer*innen aus dem eigenen Unterricht für die Gruppenarbeit zur Verfügung stellten, verstärkten die Wertschätzung. Denn sie machten deutlich erfahrbar, mit welchem Einsatz und welcher Energie die Lehrkräfte den Englischunterricht inszenieren, wie Kopf, Herz, Hand und Fuß in dem Prozess doing a lesson (Bloome et al. 1989) zusammenwirken.
Zu Beginn des PROJEKTS war eine deutliche Zurückhaltung, ja Skepsis der Lehrer*innen wahrnehmbar, Mitglieder des Forschungsteams in den Unterricht einzuladen. Denn mit dem Besuch verband sich die Vorstellung, eine ganz besondere Stunde zeigen zu müssen. Dies mögen Folgen der Ausbildung sein, denn die Mehrzahl der Lehrer*innen berichtete über negative Erfahrungen mit Unterrichtsbeobachtungen im Zusammenhang der zweiten Ausbildungsphase, dem Referendariat. Der kontinuierliche Rekurs in den monatlichen Projektsitzungen auf den Alltag und die täglichen Routinen sowie die Art und Weise, wie das Team die Besuche realisierte, haben im Laufe der Zeit ohne Frage dazu beigetragen, die Beobachtungssituationen zu entspannen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass selbst Lehrer*innen, die sich regelmäßig vom Team beobachten und videografieren ließen, immer wieder auf den Aspekt „Schaustunde“ zurückkommen, wie die folgende Äußerung zeigt:
Stimme 2
Anna: I weiß noch nicht, was ich morgen machen werde. Ich muss da später darüber nachdenken. Ich dachte, dass ich dir zeigen könnte, was ich mir vorgestellt habe. Es ist nichts Besonderes. Aber ich dachte, dass das jetzt reichen muss. Ich habe dieses Mal keine Zeit etwas Besonderes vorzubereiten. Ich muss schon früher als normaler Weise da sein um diese Frau zu treffen, damit sie die Filmausrüstung aufbauen kann.
Annas Anmerkung steht stellvertretend für andere, denn sie drückt die Sorge der Lehrer*innen aus, für die Beobachtung durch die professionellen Forscher*innen und vor allem bei geplanten Videoaufnahmen etwas Besonderes bieten zu müssen. Die Wertschätzung der alltäglichen Praxis und ihrer Routinen war deshalb eine permanente Aufgabe für das Forscher*innenteam und eine der Voraussetzungen für den Aufbau von Vertrauen.
2.3.4 Der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen
Vertrauen ist eine entscheidende Bedingung empirischer fremdsprachendidaktischer Forschung, denn es berührt alle Phasen des Forschungsprozesses, den Zugang zum Feld, die Gewinnung und Analyse der Daten, die Präsentation der Ergebnisse und den Rückzug aus dem Feld. Vertrauen ist nicht automatisch gegeben, sondern muss erarbeitet werden und braucht Entwicklungszeit. Ferner ist es höchst anfällig für Störungen: “[It is] always a fragile and momentary accomplishment, subject often to rapid shifts within encounters and over time, and always vulnerable to exigencies“ (Candlin / Chrichton 2013: 5). Aus diesem Grund verlangt es nach kontinuierlicher Pflege und erfordert die Bereitschaft und Fähigkeit der Beteiligten, mit Vertrauenskrisen umzugehen.
Die Herausforderung, vertrauensvolle Beziehungen zu schaffen und zu erhalten, begleitete das PROJEKT bis zu seinem Ende. Lehrer*innen artikulierten anfangs Enttäuschungen und Frustration über Wissenschaftler*innen, die im schulischen Kontext Daten erheben und danach nicht mehr gesehen werden: Denn fast alle hatten im Laufe ihrer Karrieren an Studien teilgenommen, ohne über Ergebnisse informiert oder in einen Diskurs über die Untersuchungen einbezogen worden zu sein. Immer wieder würden an sie Anfragen gerichtet, an einer Studie teilzunehmen:
Stimme 3
Anna: Oft sind die Umfragen ziemlich lang. Ich verstehe, warum nicht viele Lehrer antworten. Und dann machst du es und dann gibt es oft keinerlei Rückmeldung oder es dauert Jahre und dann hast du schon längst wieder vergessen, um was es in der Umfrage ging.
Anna vermisst die direkte Rückmeldung, auf die Forschung mit Praktiker*innen gerade in Hinblick auf den Erhalt vertrauensvoller Beziehungen nicht verzichten darf. Direkte Rückmeldung, hot feeedback (Sarangi / Candlin 2003: 277), etwa nach Phasen der Datenerhebung, ist jedoch nicht immer leicht zu realisieren. Trotz großer Anstrengungen gelang es dem Forschungsteam nur teilweise, (Zwischen)Ergebnisse zeitnah in die Gesamtgruppe zurückzugeben.
Читать дальше