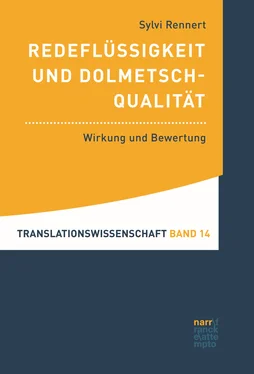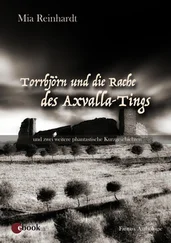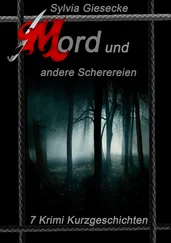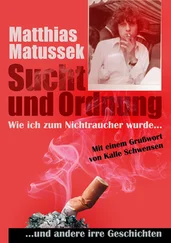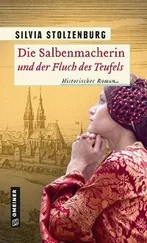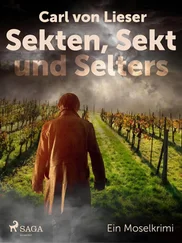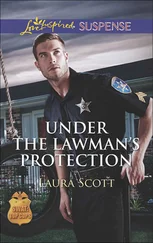Im Bereich der Dolmetschwissenschaft sehen Kurz & Pöchhacker (1995) Flüssigkeit ebenfalls als ein Zusammenwirken verschiedener temporaler Faktoren, wie Sprechgeschwindigkeit, Häsitationen, Pausen und Fehlstarts, merken aber auch an, dass nicht bekannt sei, welchen Beitrag die einzelnen Faktoren zum Eindruck der Flüssigkeit leisten:
What is conveniently labeled fluency of delivery for the purpose of user expectation surveys is actually a highly complex paralinguistic criterion which relates to such interdependent features as speaking speed, pauses, voiced hesitation, and false starts. While the relative weight of these factors in shaping judgments on the fluency of a simultaneous interpretation is not clearly understood, these paraverbal and textual parameters are at least amenable to quantitative analysis. (Kurz & Pöchhacker 1995: 354, Hervorhebung im Original)
Mead (2005: 45) berücksichtigt in seiner Bewertung der Flüssigkeit von Konsekutivdolmetschungen die temporalen Variablen Sprechrate (Wörter bzw. Silben pro Minute), Pausendauer, Anteil der Sprachproduktion an der Gesamtredezeit, Artikulationsrate (Wörter bzw. Silben pro Minute reiner Redezeit, abzüglich der Pausen) sowie die durchschnittliche Länge (in Wörtern oder Silben) von Redeabschnitten zwischen zwei Pausen. Andere Unflüssigkeiten wie Fehlstarts oder Wiederholungen schließt er hingegen von der Beurteilung aus:
Other disfluencies such as false starts and repetitions (…) are related as much to content as to rhythm and will thus not be examined in this initial exploration of interpreters’ fluency. (Mead 2005: 46)
Tissi (2000) verwendet für ihre Untersuchung von ungefüllten Pausen und Unflüssigkeiten beim Simultandolmetschen ein detailliertes Analyseschema, in dem die Oberkategorie „non-fluencies“ in „ungefüllte Pausen“ und „Unflüssigkeiten“ („disfluencies“) unterteilt wird, wobei letztere Kategorie in „gefüllte Pausen“ und „Unterbrechungen“ geteilt ist. Bei den ungefüllten Pausen wird zwischen Pausen mit grammatikalischer oder kommunikativer Funktion und ungrammatikalischen Pausen unterschieden. Gefüllte Pausen unterteilt sie in Häsitationen und Lautdehnungen, die Unterbrechungen wiederum in Wiederholungen, Strukturänderungen und Fehlstarts (vgl. Tissi 2000: 112).
Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit soll Flüssigkeit als eine Funktion verschiedener temporaler Variablen definiert werden. Die komplexe Interaktion der Variablen Pausen, Häsitationen, Fehlstarts, Selbstkorrekturen und Sprechgeschwindigkeit erweckt den Eindruck einer flüssigen oder unflüssigen Rede. Die einzelnen Variablen sollen nun im Folgenden genauer beleuchtet werden.
Unter Pausen versteht man Unterbrechungen des Redeflusses bzw. „eine Unterbrechung im akustischen Signal des geäußerten Lautkontinuums“ (Ahrens 2004: 102). Diese Unterbrechung kann aus einer ungefüllten (auch stille oder stumme Pause genannt) oder einer mit Häsitationslauten oder anderen Unflüssigkeiten wie Lautlängungen gefüllten Pause bestehen (siehe Abschnitt 2.2.2.2).
Eine Definition rein über das akustische Signal ist allerdings problematisch, da Pausen von ZuhörerInnen auch an Stellen wahrgenommen werden können, an denen es gar nicht zu einer tatsächlichen Unterbrechung des akustischen Signals kommt, beispielsweise beim Reset der Grundfrequenz zu Beginn einer neuen Intonationseinheit (vgl. Ahrens 2004: 102) oder bei der Dehnung von Lauten vor oder als Ersatz für eine Pause (vgl. Pompino-Marschall 1995: 237). Diese sogenannte präpausale Längung ist laut Pompino-Marschall (1995: 237) eine „lokale Verlangsamung der Sprechgeschwindigkeit“, durch die sich die Dauer der betroffenen Lautsegmente erhöht und die zur auditiven Wahrnehmung einer Pause führt, selbst wenn keine echten Signalpause vorliegt (vgl. Pompino-Marschall 1995: 238). Andererseits kommt es wiederum bei bestimmten Lauten (stimmlosen Verschlusslauten) zu einer Pause im akustischen Signal, die sogar länger sein kann als manche wahrgenommene Pausen, aber nicht als solche empfunden wird (vgl. Ahrens 2004: 102, Laver 1994: 536, Pompino-Marschall 1995: 174).
Viele AutorInnen geben eine Mindestlänge für Pausen an, die allerdings stark variiert: Während Goldman-Eisler (1968: 12) 0,25 Sekunden als Minimalwert betrachtet um artikulationsbedingte Unterbrechungen (z.B. durch aufeinander treffende Verschlusslaute) auszuschließen, stellen Hieke et al. (1983) fest, dass viele Pausen im Bereich zwischen 0,13 und 0,25 Sekunden eine kognitive Funktion haben, weshalb sie eine Mindestlänge von knapp über 0,10 Sekunden vorschlagen. Eine eindeutige Untergrenze für Pausen ist auch deshalb schwer festzulegen, weil die Länge, ab der eine Pause wahrgenommen wird, stark von ihrer Position abhängig ist. Butcher (1981) stellt fest, dass Pausen an syntaktischen Positionen von den meisten ZuhörerInnen erst ab einer Länge von 220 ms wahrgenommen werden, an nichtsyntaktischen Positionen aber bereits ab rund einem Drittel dieses Wertes:
… whereas breaks between tone groups are not heard by 75 % of listeners until they are approximately 220 ms long, breaks within tone groups are heard by the same proportion of listeners when only 80 ms long. (Butcher 1981: 205)
Obwohl Unterbrechungen des Sprachsignals mit moderner Audiobearbeitungssoftware leichter identifiziert werden können, ist es nicht immer möglich, zwischen einer sehr kurzen Pause und einer kurzen physiologisch bedingten Unterbrechung des Sprachsignals zwischen zwei Lauten zu unterscheiden (Pradas Macías 2015: 166).
Pausen können nach ihrer Funktion oder Position unterschieden werden, wobei diese beiden Faktoren häufig zusammenhängen. So trifft etwa Laver (1994: 537) die funktionelle Unterscheidung zwischen „hesitation pauses“ und „juncture pauses“ danach, ob sie innerhalb oder zwischen Intonationseinheiten liegen. Eine ähnliche, auf der Position basierende Einteilung sind die „tentative and final pauses“ (Pike 1967: 31), also Pausen innerhalb oder am Ende von grammatikalischen Einheiten. Ihrer Funktion nach können Pausen physiologisch, kognitiv oder semantisch bzw. grammatikalisch bedingt sein. So fallen etwa Atempausen und Artikulationspausen in die Kategorie der physiologischen Pausen, während kognitiv bedingte Pausen vornehmlich der Sprachplanung dienen (Goldman-Eisler (1968: 12) bezeichnet diese als „hesitation pauses“). Pausen semantischer bzw. grammatikalischer Natur treten beispielsweise auf, wenn sie der Abgrenzung einzelner Redeteile voneinander bzw. der Strukturierung der Rede dienen (vgl. Butcher 1981: 209f., Goldman-Eisler 1968). Sowohl in spontaner als auch in gelesener Sprache stehen Atempausen häufig in syntaktischen Positionen (vgl. Ahrens 2004: 186–187, Butcher 1981: 112, Chambers 1997: 539, Schmitz 2008: 19), da in der normalen Sprechplanung physiologische und kognitive Prozesse aufeinander abgestimmt werden können. Da beim Dolmetschen aufgrund der Abhängigkeit von der ProduzentIn des Ausgangstextes (AT) die Planung nicht immer autonom möglich ist, ist dies laut Ahrens (2004: 187) eine mögliche Erklärung für die manchmal nicht-syntaktische Positionierung von Pausen im ZT.
Die Position entscheidet nicht nur darüber, ab welcher Länge eine Pause als solche wahrgenommen wird, sondern auch darüber, ob sie für die Verarbeitung durch die ZuhörerInnen hilfreich oder störend ist. Pausen können eine kommunikative Wirkung haben, etwa wenn sie die Aufmerksamkeit auf das nachfolgende Wort lenken (vgl. Lindner 1969: 211), und auch rhetorisch wirkungsvoll eingesetzt werden. Pausen zwischen Intonations- bzw. Informationseinheiten grenzen diese voneinander ab und erfüllen somit eine wichtige Funktion bei der Segmentierung des Sprechflusses (vgl. Ahrens 2004: 104f., Goldman-Eisler 1968: 13). Ahrens (2004) unterscheidet daher auch sinnunterstützende und störende Pausen nach ihrer Position:
Читать дальше