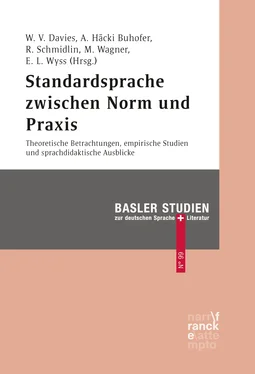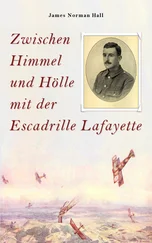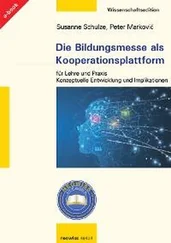Standardsprache zwischen Norm und Praxis
Здесь есть возможность читать онлайн «Standardsprache zwischen Norm und Praxis» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Standardsprache zwischen Norm und Praxis
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Standardsprache zwischen Norm und Praxis: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Standardsprache zwischen Norm und Praxis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Standardsprache zwischen Norm und Praxis — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Standardsprache zwischen Norm und Praxis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Diese sprachliche Heterogenität steht anscheinend in krassem Widerspruch zu der Annahme, dass sich die politische Einigung auf die Einheit der Sprache gründete und darin ihre Rechtfertigung fand. Diese Auffassung war jedoch im 19. Jahrhundert – vor allem im Nachhinein, nach der Reichsgründung 1871 – allgemein akzeptiert, und sie gilt auch heute noch als Gemeinplatz der Geschichte. In einer Rezension des Bandes, in dem Durrell (2002) erschien, schrieb Bonnell (2003: 146), dass Durrells Beitrag „challenges long-conventional assumptions about German linguistic unity preceding political unity“. An dieser Stelle möchte ich jedoch die in Durrell (2002) vertretenen Ansichten sowie auch den Topos der sprachlichen Einheit als Grundlage für die politische Einigung revidieren, denn erstens ist es klar, dass man trotz der eben besprochenen Vielfalt der Erscheinungsformen schon im ausgehenden 18. Jahrhundert von einer „deutschen Sprache“ in einem in diesem Zusammenhang relevanten Sinne sprechen kann. Und zweitens hat es um diese Zeit trotz der späteren Behauptungen einer nationalistischen Ideologie auch ein politisches Gebilde gegeben, das wir mit guten Gründen als einen „deutschen“ Staat bezeichnen dürfen und in dem die deutsche Sprache die wesentlichen Stadien im Prozess der Standardisierung durchmachte. Dieses Gebilde war dann ein wichtiger Fokus für die nationale Identität. Diese Erkenntnis ist m.E. eine klare Folgerung aus der neuen historischen Forschung, insbesondere Whaley (2012) und Wilson (2016), die die Geschichte des „Alten Reichs“ völlig neu evaluiert hat und Einsichten bietet, die eine Überprüfung der herkömmlichen Ansichten über das Verhältnis von Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum in dieser Zeit notwendig machen.
2. Der ethnolinguistische Nationalismus im 18. und 19. Jahrhundert
Bei dem ersten der zu besprechenden Themen ist es aus der Perspektive der modernen Soziolinguistik klar, dass die Tatsache der sprachlichen Heterogenität für die Annahme einer vorwiegend ethnolinguistischen Grundlage für den deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert problematisch erscheinen dürfte. Jedoch erscheint diese Annahme durch die Aussagen zeitgenössischer Autoren als vollständig gerechtfertigt. Im 1785 erschienenen 2. Teil seiner „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ hatte Herder die Ansicht vertreten, dass die Sprache die menschliche Natur widerspiegele und dass jede Sprache also der unverkennbare Ausdruck des Charakters eines besonderen Volkes in der menschlichen Gemeinschaft sei. Für ihn waren alle Sprachen gleichberechtigt und hatten jeweils das Wesentliche der Identität des Sprachvolks durch alle Zeiten gestiftet. So sei nach ihm der natürlichste Staat (Herder 1984: III/1, 337) „also Ein Volk, mit Einem Nationalcharakter“, denn die Sprache verbinde ein Volk mit seiner Vergangenheit und die Grenzen eines jeweiligen Staates sollten sich mit dem historischen Territorium des Sprachvolks decken.
Herders Überlegungen zum Verhältnis von Volk, Sprache und Staat wurden während der traumatischen Jahre der napoleonischen Kriege und nach dem Ende des „Alten Reichs“ weiter ausgebaut zu einem klar artikulierten nationalistischen Diskurs. Dieser neue Nationalismus sah genau wie Herder die Sprache als bestimmendes Merkmal der deutschen Nation. Das dringendste Ziel war aber jetzt die Befreiung der deutschen Lande und der deutschen Kultur von der Bedrohung durch die fremde Herrschaft und so findet man etwa bei Fichte nicht mehr Herders Annahme einer grundsätzlichen Gleichheit aller Sprachen, sondern die Vorstellung der grundlegenden Überlegenheit der deutschen Sprache insbesondere gegenüber der französischen. So liest man in den „Reden an die deutsche Nation“ (zit. nach Dieckmann 1989: 45):
Das deutsche Volk ist das ursprüngliche, das unverfälschte Volk, das gegen die militärische wie kulturelle Unterjochung durch Frankreich um seine Freiheit und Identität kämpft und dabei im Dienste eines höheren geschichtlichen Auftrags handelt. […]
Nach Jahrtausenden, und nach allen den Veränderungen, welche in ihnen die äußere Erscheinung der Sprache dieses Volks erfahren hat, bleibt es immer dieselbe Eine, ursprünglich also ausbrechenmüssende lebendige Sprachkraft der Natur, die ununterbrochen durch alle Bedingungen herab geflossen ist, und in jeder so werden mußte, wie sie ward, am Ende derselben so seyn mußte, wie sie jezt ist, und in einiger Zeit also seyn wird, wie sie sodann müssen wird. Die reinmenschliche Sprache zusammengenommen zuförderst mit dem Organe des Volks, als sein erster Laut ertönte; was hieraus sich ergiebt, ferner zusammengenommen mit allen Entwiklungen, die dieser erster Laut unter den gegebnen Umständen gewinnen mußte, giebt als letzte Folge die gegenwärtige Sprache des Volks. Darum bleibt auch die Sprache immer dieselbe Sprache.
Hier findet man alle wesentlichen Bestandteile des ethnolinguistischen Nationalismus, so etwa den Begriff eines Volks, das durch seine einzigartige, überlegene Sprache gekennzeichnet ist. Der Charakter des Volks findet in dieser Sprache seinen unvergleichlichen Ausdruck; anders als die Franzosen, die ihr ursprüngliches Fränkisch gegen das Romanische getauscht haben, hat das deutsche Volk seine Sprache immer bewahrt, und zwar in einer Form, die trotz oberflächlicher Veränderungen immer gleich geblieben ist. Dieses Volk hat das Recht auf ein unabhängiges, einheitliches politisches Gebilde in seinem ererbten Territorium ohne Fremdherrschaft.
Im 19. Jahrhundert wurde dann die Gleichsetzung von Sprache und Nation in Deutschland (wie auch oft anderswo) kaum hinterfragt. Für Hegel bildete der Volksgeist die Basis des Staats (vgl. Barnard 1965: 166–167) und für Jacob Grimm (1884: VII, 557) war bekanntlich „ein volk […] der inbegriff von menschen, welche dieselbe sprache reden“, wie er in seiner berühmten Rede auf der Germanistenversammlung in Frankfurt im Jahre 1846 behauptete. Der britische Historiker Eric Hobsbawm (1992: 103) erklärte, dass man insbesondere in Bezug auf Deutschland nicht darüber staunen sollte, dass diese Ein-Volk-eine-Sprache-Ideologie vor allem dort verbreitet war, denn:
For Germans […], their national language was not merely an administrative convenience or a means of unifying state-wide communication […]. It was more even than the vehicle of a distinguished literature and of universal intellectual expression. It was the only thing that made them Germans […], and consequently carried a far heavier charge of national identity than, say, English did for those who wrote and read that language.
Am wichtigsten ist jedoch die Perzeption von gebildeten Deutschen im 19. Jahrhundert, dass für sie in erster Linie die Sprache identitätsstiftend war, dass dieses Identitätsgefühl das Streben nach einem einheitlichen Staat legitimierte und die Basis dafür bilden sollte. Der Topos, dass es allein die gemeinsame Sprache gewesen sei, die die Nation während der Jahre der politischen Fragmentierung nach dem Wiener Kongress zusammengehalten habe, sowie auch deren ideologische Bedeutung für die Reichsgründung 1871, kommt in einer Streitschrift von Emil du Bois Raymond vom Jahre 1874 sehr klar zum Ausdruck (zit. nach Dieckmann 1989: 348): „Die Sprache war lange beinahe das einzige Band, welches die jetzt das Reich ausmachenden deutschen Stämme zusammenhielt. Ihr verdankt das Reich seine Neuerstehung.“ Und in seinem großen Standardwerk zur Geschichte der deutschen Sprache akzeptiert von Polenz (2013: 10–11) sehr klar die Annahme, dass die politische Einigung auf der Basis der eher erfolgten identitätsstiftenden sprachlichen Einigung geschah:
Im Laufe des 18. Jh.s hat die kulturpatriotische Bewegung – mehr als ein Jahrhundert vor der Gründung eines deutschen Nationalstaates – die Kodifizierung und gesellschaftliche Anerkennung der deutschen Schriftsprache als Kulturnationalsprache in den Oberschichten erreicht und auch in den deutschen Mittelschichten bis um 1800 eine mindestens passive deutsche Schriftsprachkompetenz und Sprachloyalität von der Nord- und Ostseeküste bis in die Alpenländer bewirkt. Sie stellt eine wichtige, aber noch rein kulturelle, noch nicht auf staatliche Macht hin orientierte Voraussetzung für die Entstehung des schwierigen, zwischen Kultur und Politik widersprüchlichen deutschen Nationalbewusstseins im 19. Jh. dar.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Standardsprache zwischen Norm und Praxis»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Standardsprache zwischen Norm und Praxis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Standardsprache zwischen Norm und Praxis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.