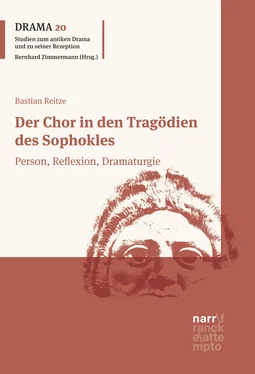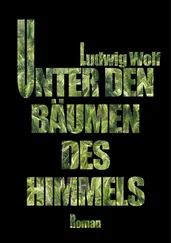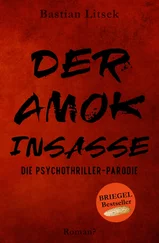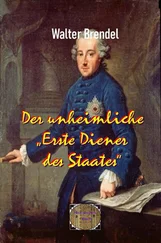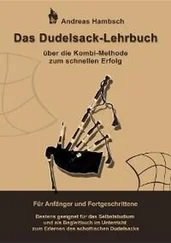Von besonderem Interesse sind weiterhin die im besten Sinne sparsam,3 aber mit besonderer Absicht eingebundenen chorischen Äußerungen innerhalb des ersten Epeisodions. Neben der standardisierten Auftrittsankündigung v. 539ff. und der kurzen, aber bedeutsamen Kommentierung v. 317f. fallen dabei besonders die beiden metrisch korrespondierenden Strophen v. 391–402 sowie 506–518 ins Auge. Machen wir uns vor einer kurzen Analyse dieser Partien den Ablauf der Situation überblicksartig klar.
Mit dem Auftritt des Protagonisten in Vers 219 entspinnt sich zwischen ihm und Neoptolemos eine erste Unterredung, in der die beiden Gesprächspartner die nötigen Informationen untereinander austauschen. Zunächst ist es an Philoktet, Herkunft, Namen und Zielort seines Gegenübers zu erfahren: Die Freude, Griechen getroffen zu haben (v. 234f.), wird dabei durch die Überraschung, gerade den Sohn Achills vor sich zu wissen, noch übertroffen (v. 242) und findet im Erstaunen über die Teilnahme des jungen Mannes am Kriegszug gegen Troia seinen Höhepunkt (v. 246). Neoptolemos – ganz seiner Rolle innerhalb der Intrige gemäß – gibt sich unwissend (v. 253) und bietet so dem Protagonisten die Möglichkeit zu einer umfangreichen Vorstellung seiner Person, der Vorgeschichte und der momentanen Situation (v. 254–316). Schon oben wurde auf die besondere Einbindung dieses Monologs in den Ablauf der expositorischen Teile des Dramenbeginns hingewiesen. Es reicht daher, Folgendes zu bemerken: Die Zuschauer – ebenso wie die an der Szene beteiligten dramatischen Personen – erfahren aus dem Mund Philoktets keine wesentlichen neuen Informationen; die emotionale Ausgestaltung der sogar Neoptolemos bereits bekannten Fakten (Philoktets Identität, seine Krankheit, Aussetzung, Ernährung auf der Insel sowie deren Beschaffenheit und die daraus folgende Einsamkeit) lässt allerdings aufhorchen. Indem hier der Betroffene selbst zum ersten Mal umfangreich seine Perspektive der Dinge darlegt, wird aus dem bisher maßgeblichen Reden über den Protagonisten die Selbstdarstellung des entscheidenden Charakters. Dass mit den Ausführungen Philoktets die Imagination des Chors in gewisser Weise gespiegelt bzw. beantwortet wird, ist oben schon erwähnt worden.
Es überrascht daher nicht, dass die erste Kommentierung des Monologs (v. 317f.) gerade dem Chorführer zufällt; vielmehr ist dieser anscheinend standardisierte Hinweis auf die Sympathie mit dem Sprechenden bewusst in den Zusammenhang eingepasst.4 Machen wir uns klar: Philoktet hatte zum Abschluss seiner Ausführungen dargelegt, wie zufällig und unfreiwillig auf Lemnos Gelandete ihn zwar mit Worten bedauerten, ihm Essen und Kleidung bereitstellten, ihn jedoch trotz seiner Bitten nicht nach Hause brächten (v. 305ff.). Nach einer zusammenfassenden Verfluchung der aus Sicht des Protagonisten für seine Leiden verantwortlichen Heerführer bekundet schließlich der Chor sein Mitgefühl: „Auch ich scheine gleich den hier angekommenen Fremden dich zu bemitleiden, Sohn des Poias“ (v. 317f.). Bemerkenswert ist dabei der Rückgriff auf den Beginn des zweiten Strophenpaars: Hatte dort die zweite Strophe in Vers 169 mit den Worten οἰκτίρω νιν ἔγωγʼ – also der betonten Formulierung einer eigenen Position – begonnen, so bietet die Formulierung an unserer Stelle κἀγὼ ἐποικτίρειν σε sogar eine wörtliche Reminiszenz. Die kurze, formal dem Standard chorischer Kommentierung folgende Äußerung ruft so erneut die ausgreifende Imagination und deren emotionale Färbung ins Gedächtnis; die Ausführungen des Protagonisten werden endgültig zur lyrischen Partie vom Eingang des Stücks in Beziehung gesetzt, geradezu gerahmt und damit fest im motivischen Ablauf der einzelnen Teile verortet.
Die Frage, ob der Chor an unserer Stelle echtes Mitleid bekundet oder geradezu heuchelnd zum Mitspieler der Intrige wird, ist so schwierig wie umstritten – und für die vorliegende Untersuchung von geringer Bedeutung. Ein rascher Blick auf die gängigen Ansichten soll genügen: Während BURTON bemerkt „the coryphaeus comments on Philoctetesʼ speech with an expression of pity“5 und KAMERBEEK vorsichtig anmerkt: „some irony is perhaps to be perceived“,6 ist sich SCHMIDT sicher:
Es bleibt völlig im Unklaren, ob er [sc. der Chor] wirklich beeindruckt und von echtem Mitleid erfaßt ist oder ob ihn der Einsame nur wie die vorher Angekommenen dauert, die ihm kleine Trostgaben zukommen ließen. […] Nach den bewegenden Strophen in der Parodos läßt sich eine herzliche Teilnahme an den Klagen des Ph[iloktet] erwarten, wie sie einige Interpreten deshalb auch gefunden haben. Statt dessen reagieren die Seeleute jedoch mit allem Bedacht verstellt!7
Sicherlich weist SCHMIDT dazu mit Recht auf die „geschraubte Formulierung“ hin, „die, in sich schon zweideutig und vage, durch das ἔοικα noch halb wieder zurückgenommen wird“.8 Ob man allerdings dem Chorführer eine innere Anteilnahme gänzlich absprechen kann, scheint mit Blick auf die Reminiszenz an Vers 169 und der dort ausgedrückten emotionalen Einbindung fraglich. Die durch die Formulierung intendierte Ambivalenz ist zwar offenkundig, lässt sich allerdings aus der dramatischen Situation heraus als ein vorsichtig abwartendes und dennoch strategisch kluges Herantasten an die beherrschende Figur des Protagonisten deuten.9 Der Wahrheitsgehalt der Mitleidsbekundung steht dabei zunächst nicht zur Debatte. Anders gesprochen: Die kurze Kommentierung durch den Chor(-führer) bietet den Auftakt für die sich anschließende Unterredung zwischen Philoktet und Neoptolemos und ist zu diesem Zweck so unverfänglich wie möglich.10 Ob dabei einem Gefühl der Anteilnahme Ausdruck verliehen wird oder die Bemerkung als reine Verstellung zu werten ist, bleibt zunächst unbeantwortet, ja wird bewusst in der Schwebe gehalten. Solange die sicherlich intendierte Ambivalenz der Aussage vom Rezipienten wahrgenommen wird und so ihre Wirkung entfaltet, ist eine Diskussion der inneren Beweggründe des Akteurs von geringerer Bedeutung.
Zunächst sollen die weiteren Äußerungen des Chors innerhalb des Epeisodions betrachtet werden. Dem kurzen Wechselgespräch der beiden Akteure in den Versen 319–342, in dem der Protagonist mit der Nachricht vom Tod des Achill konfrontiert wird, schließt sich die ausführliche Trugrede des Neoptolemos an (v. 343–390). Wortreich schildert er darin seine (angebliche) Kränkung durch Odysseus und die Atriden, die ihm die Waffen seines verstorbenen Vaters vorenthielten. Wirkungsvoll wird dabei die erfundene Situation durch die scheinbar wörtlich wiedergegebenen Reden der Beteiligten (Atriden, Neoptolemos selbst sowie Odysseus) ausgestaltet (v. 364–367, 369f., 372f. und 379–381). Diese heftige Auseinandersetzung, so Neoptolemos, sei der Grund für seine Abreise von Troia gewesen (v. 383). Letztlich mache er jedoch nicht Odysseus, sondern die Atriden für die erlittene Entehrung verantwortlich; deswegen sei ihm selbst und den Göttern jeder willkommen, der den in Rede stehenden Anführern feindlich gesonnen sei (v. 385–390). Dabei bildet diese implizite Verfluchung den Schlusspunkt der Ausführungen, der durch das vorgeschaltete λόγος λέλεκται πᾶς (v. 389) besonders herausgehoben ist. Der über die Intrige informierte Zuschauer und Leser hört den jungen Mann an dieser Stelle geradezu aufseufzen: Er hat sich bei seiner ersten Begegnung mit Philoktet bewährt, seine moralischen Zweifel überwunden und eine überzeugende Trugrede dargeboten, die ihre Wirkung nicht verfehlen wird.
Von besonderer Bedeutung für unsere Untersuchung sind die folgenden Verse 391–402. Sophokles lässt auch hier auf einen wichtigen Monolog eine kurze Kommentierung durch den Chor folgen, erweitert allerdings den standardisierten Doppelvers11 (vgl. v. 317f.) hin zu einer vollklingenden Orchestration der verklungenen Rhesis des Akteurs. Der formalen Analyse der Passage wird ihr inhaltlicher Nachvollzug und ihre motivische Einordnung folgen.
Читать дальше