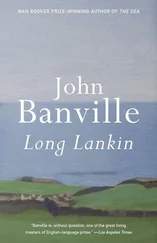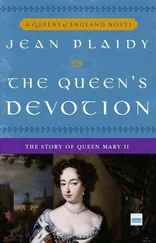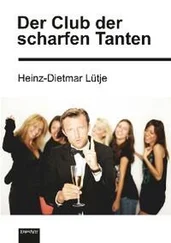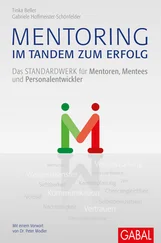Ebenfalls davon ausgehend, dass sich die Beteiligung der Lerner an der fremdsprachenunterrichtlichen Kommunikation nicht auf ihre Reaktion auf die lehrerseitigen Fragen beschränken, untersucht Schwab (2009) die Lerneraktivitäten bei den Gesprächsinitiativen. Aufgrund seiner empirischen Untersuchung weist der Autor darauf hin, dass die lernerseitigen Beitragsinitiativen spontansprachlich und im Kontext von lehrerinitiierten Rahmenhandlungen als Einschubseqeunzen eingebettet sind. Konkret analysiert er die Lernerinitiativen unter vier Aspekten, nämlich in ihrer sequenziellen Positionierung, in ihrer semantischen bzw. inhaltlichen Positionierung, in ihrer relationalen Positionierung (im Verhältnis zu den sprachlichen Aktivitäten der Lehrkraft und der Mitschüler) und in ihrer räumlich-interaktionalen Positionierung. Damit ermöglicht Schwab (2009) ein Gesamtbild, mit dem man die lernerinitiierten Gesprächssequenzen als eigenständige Sprachhandlungen innerhalb des lehrerzentrierten Unterrichts betrachten kann.
Bezogen auf die Organisation der Gespräche im Fremdsprachenunterricht werden in der Konversationsanalyse vor allem Sprecherwechsel (turn taking) und Reparatur erforscht. Das System des Sprecherwechsels gilt als ein grundsätzliches Element der Konversation. Die Organisation des Sprecherwechsels gehört zu den frühesten Forschungsgebieten der Konversationsanalyse (Sacks et al. 1974). Diese Methode zeigt, dass sich der Fremdsprachenunterricht durch seine spezifischen Systeme des Sprecherwechsels auszeichnet. Eine der bisher umfassendsten Studien dazu stellt Seedhouses (2004) empirische Forschung dar. Er arbeitet heraus, dass es unmöglich ist, von einem einzigen System des Sprecherwechsels in der fremdsprachenunterrichtlichen Kommunikation auszugehen. Die Organisation des Sprecherwechsels im Fremdsprachenunterricht hängt vom pädagogischen Fokus ab. In Kontexten mit unterschiedlichen pädagogischen Zielen sind verschiedene Systeme des Sprecherwechsels zu beobachten. In seiner Studie findet Seedhouse (2004) vier fremdsprachenunterrichtliche Kontexte, die verschiedene pädagogische Fokusse verfolgen:
Form und Exaktheit
Bedeutung und Fluss
aufgabenorientiert
prozedural.
Nach seinem Befund variieren die Systeme des Sprecherwechsels deutlich in diesen verschiedenen Kontexten. Während im prozeduralen Unterrichtskontext z.B. die lehrerseitigen Monologe ohne Sprecherwechsel einen großen Anteil ausmachen, sind im Kontext, der sich an Bedeutung und Fluss orientiert, zahlreiche Sequenzen mit Sprecherwechsel zu sehen. Des Weiteren lässt sich in dieser Studie feststellen, dass die Organisation des Sprecherwechsels im Fremdsprachenunterricht nicht ausschließlich der Steuerung der Lehrperson unterliegt. Die Lerner leisten lokal und kreativ auch einen Beitrag zur Gestaltung des Sprecherwechsels.
Ein besonderes Thema, das in der Kommunikation mit nicht kompetenten Sprechern häufig behandelt wird, ist die Reparatur. Während die Reparaturhandlungen in nicht-institutionellen MS-NMS-Konversationen eher spontan und interapersonal sind, verdeutlicht die konversationsanalytische Zweitspracherwerbsforschung, wie die Reparatursequenzen im Fremdsprachenunterricht systematisch organisiert werden.
Jung (1999) untersucht Reparatursequenzen anhand von Videodaten (60 Minuten) aus einem Fremdsprachenunterricht (Englisch als Fremdsprache) an einer amerikanischen Universität für Erwachsene aus Afrika, Ostasien und Südamerika. Der Fokus des aufgenommenen Unterrichts liegt darin, das Hörverständnis und die Sprechfähigkeit der Lerner zu fördern und damit ihre kommunikative Kompetenz voranzutreiben. Die empirische Untersuchung mit konversationsanalytischer Methode zeigt, dass die „participation frameworks“ (Jung 1999: 167) eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Reparatursequenzen im Fremdsprachenunterricht spielen. Jung (1999) unterscheidet dabei „learner role-playing activities“ von „teacher-fronted activities“ und beschreibt die Organisation der Reparatursequenzen in dem jeweiligen Kontext. In „learner role-playing activities“, in denen die Lerner Dialoge in Form vom Rollenspiel durchführen, manifestieren sich verschiedene Variationen der Reparatursequenzen, wie selbstinitiiert und selbstdurchgeführt, selbstinitiiert und fremddurchgeführt, fremdinitiiert und fremddurchgeführt. Dagegen zeichnen sich „teacher-fronted activities“, in denen die Lehrperson den Lernern Fragen stellen, durch fremdinitiierte und fremddurchgeführte Reparatursequenzen aus.
Angeregt von Jung (1999) und Kasper (1986), die ausführen, dass die Organisation der Reparatursequenzen nicht monolithisch, sondern im Zusammenhang mit dem pädagogischen Fokus steht, führt Seedhouse (2004) eine weitere empirische Studie mit konversationsanalytischer Methode an. Konkret analysiert er die Gestaltung der Reparatursequenzen in drei fremdsprachenunterrichtlichen Kontexten, die jeweils Form und Exaktheit, Bedeutung und Fluss und aufgabenorientierte Interaktion als ihre pädagogischen Ziele setzen. Anhand seiner Daten beschreibt er die Reparatursequenzen im Fremdsprachenunterricht unter den folgenden vier Gesichtspunkten:
typische Beteiligten bei der Reparatur
typische Trajektorien der Reparatur
typische Typen der Reparatur
typischer Fokus der Reparatur (d.h. was ist reparierbar) (Seedhouse 2004: 142).
Seine Untersuchung bestätigt, dass es zwischen dem pädagogischen Fokus und der Organisation der Reparaturen eine reflexive Beziehung gibt. Ändert sich der pädagogische Fokus, kommt eine veränderte Reparaturgestaltung vor.
Ein Blick auf die Forschungslage zeigt, dass die konversationsanalytische Methodologie ein hilfreiches Instrumentarium bietet, um die Interaktionsorganisation im Fremdsprachenunterricht zu rekonstruieren und die enge Verknüpfung von sozialer Interaktion und Spracherwerb zu erfassen. Zur Bedeutung der Konversationsanalyse für die Fremdspracherwerbsforschung schreibt Schwab (2009):
Die konversationsanalytische Methodologie kann also keine unmittelbaren Antworten auf die in der Psycholinguistik gestellten Fragen nach Lernen/Erwerben als individuell-kognitivem Prozess geben. Sie kann aber helfen, fremdsprachliches Lernen/Erwerben zu erklären, indem das Bild von Spracherwerb um eine sozial-interaktive Ebene erweitert wird. (Schwab 2009: 109)
Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine empirische Untersuchung der chinesisch-deutschen Tandeminteraktion mit konversationsanalytischer Methode. Im Folgenden werde ich darauf eingehen, wie die Daten erhoben wurden. Außerdem werde ich relevante Angaben zu den Probanden machen. Schließlich wird die Aufbereitung der Daten für meine Forschung erläutert.
Am Anfang aller Gesprächsaufnahmen im chinesisch-deutschen Tandem fand ich in meinem Freundeskreis in Freiburg vier Tandempaare, die bereit waren, an meinem Forschungsprojekt teilzunehmen. Außerdem vermittelte ich einer chinesischen Studentin, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen gerade in Freiburg angekommen war, auf ihren Wunsch hin eine deutsche Tandempartnerin. Mit ihrem Einverständnis wurde sie auch in meine Forschung aufgenommen. Darüber hinaus versuchte ich auch, potenzielle Probanden durch Aushänge in der Universität und Ankündigungen im Sozialnetzwerk (wie Facebook) oder Internetplattform (wie Verband der chinesischen Studierenden in Freiburg) zu finden. Da hat sich aber nichts ergeben. Es gelang mir also, insgesamt fünf Tandempaare zu Zwecken der Untersuchung zu gewinnen.
Für die Auswahl der Probanden setzte ich hauptsächlich zwei Kriterien. Erstens sollten die Teilnehmer die Grundvoraussetzung der Tandemidee erfüllen. Der eine spricht Chinesisch als Muttersprache und lernt Deutsch. Der andere soll ein deutscher Muttersprachler sein, der Chinesisch lernt. Sie versuchen, einander beim Sprachenlernen zu helfen. Zweitens war es wichtig, dass sie sich regelmäßig und möglichst länger als vier Monate treffen.
Читать дальше