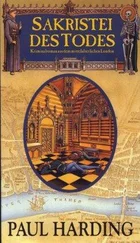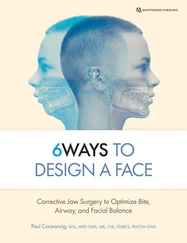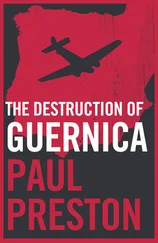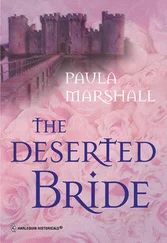1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 Daß den Katholiken die »Juden und Liberalen« ein Dorn im Auge waren, hatte seine guten Gründe. Die Liberalen hatten seit der Gründung des Reichs bereitwillig an einer undemokratischen Regierung teilgenommen und sich in der Freundschaft des Kanzlers gesonnt. Prominente Juden wie Lasker waren an dem parlamentarischen Kampf für die antikatholische Gesetzgebung von 1873 eifrig beteiligt gewesen. Dem berühmten Pathologen Rudolf Virchow, einem der Begründer der Fortschrittspartei und Befürworter der Bismarckschen Katholikenverfolgung, wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, den Begriff »Kulturkampf« prägen zu dürfen. Die Berliner liberale Presse, mit der viele Juden verbunden waren, hatte einen Kreuzzug gegen Konservative und katholische »Reichsfeinde« geführt und geholfen, das Prädikat »ultramontan« zu einem der populärsten Schmähworte der Zeit zu machen, zu einem Begriff, in dem sich liberale Aufklärung gegen katholisches Dogma mit nationalistischer Feindseligkeit gegen eine Autorität verband, die ihren Sitz ultra montes hatte, nämlich im Vatikan.
Die antisemitische Agitation des katholischen Lagers endete jäh und unter merkwürdigen Umständen. Ein katholisches Blatt in der Provinz, die Schlesische Volkszeitung, hatte mit dem Nachdruck der Germania-Artikel begonnen, unterbrach aber die Reihe plötzlich und veröffentlichte am 2. Oktober 1875 eine Erklärung, in der es sich von dem Inhalt der Artikelserie lossagte 43). Haß gegen die Juden sei unvereinbar mit christlicher Nächstenliebe, stellte das Blatt fest und fragte sich, ob die Germania nicht der Kreuzzeitung in die Falle gegangen sei; der Verfasser der Germania-Artikel könne sehr wohl Hermann Wagener sein, ein Vertrauter Bismarcks, und die Anregung sei möglicherweise direkt vom Kanzler gekommen, der auf diese Weise eine Änderung seiner Politik vorbereiten wolle. Ob die Schlesische Zeitung mit dieser Vermutung recht hatte, läßt sich kaum feststellen. Wawrzinek 44) nimmt an, daß die Germania-Artikel von Joseph Cremer stammten, der später einer der Führer und Bismarcks Agent in Adolf Stoeckers antisemitischer Berliner Bewegung wurde. Ob jedoch von oben inspiriert oder nicht, die Artikel taten ihr Werk: zwei ehemalige politische Opponenten stießen auf einen gemeinsamen Feind. In der antijüdisch-antiliberalen Kampagne fanden sich katholische Gegner des Preußentums und protestantisch-konservative Antikatholiken zusammen.
Von der liberalen Geschichtsschreibung ist das heftige Aufflammen von politischem Antisemitismus in den katholischen Kreisen der siehziger Jahre oft als eine bedauerliche Episode in einer sonst harmonischen Beziehung zwischen zwei Minderheitsgruppen betrachtet worden, als ein faux pas der gereizten Kirche, den sie schnell wieder korrigiert habe. Eine solche Erklärung dürfte kaum genügen. Die Zentrumspartei war dabei, eine exponierte strategische Stellung im Reichstag zu beziehen, die sie von 1879 bis zum Ende der Weimarer Republik nicht wieder verlieren sollte. Als eine konfessionelle Partei, deren Mitglieder sich aus allen sozialen Klassen rekrutierten, war sie in der Lage, politische Bündnisse mit der Rechten und der Linken einzugehen, ohne befürchten zu müssen, ihre Anhänger könnten ihr davonlaufen. Als Bismarck Ende der siebziger Jahre den Kulturkampf abbrach, gewährten ihm die Katholiken als Gegenleistung bedingte parlamentarische Unterstützung. Die nationalliberale Ära war vorbei; mit ihr erlosch der stärkste Anlaß für Antisemitismus in den katholischen Reihen (45).
Die Strategie der Katholiken den Juden gegenüber hatte also wohl ebensowenig etwas mit christlichen Prinzipien zu tun wie die der protestantischen Konservativen. In erster Linie waren es politische Erwägungen, von denen sich der Katholizismus leiten ließ. Daß seine Beziehung zu den Juden im weiteren Verlauf der deutschen Geschichte nicht unfreundlich war, beruhte auf anderen Faktoren als auf dem christlichen Glauben an die Brüderlichkeit der Menschen (46).
In seinem Vorhaben, Deutschland zu einigen und zu einer modernen Großmacht zu entwickeln, war Bismarck gezwungen gewesen, sich auf den Liberalismus zu stützen, nicht aus innerer Neigung, sondern weil die immer noch halbfeudale preußische Aristokratie seinen Plänen lauwarm gegenüberstand. Schon in den siebziger Jahren jedoch wurde es immer klarer, daß es auf die Dauer kaum möglich sein werde, das Reich mit einer liberalen Mehrheit zu regieren, ohne dafür drastische Änderungen in der Machtstruktur des Staates in Kauf nehmen zu müssen. Schon seit der Reichsgründung standen die nivellierenden Tendenzen von Handel und Industrie in scharfem Konflikt mit den ständischen Interessen der preußischen Aristokratie und Monarchie. Das Staatsgefüge konnte diese Spannungen nicht eliminieren, sie lagen in ihm selbst begründet (47).
Während seiner ganzen Kanzlerschaft war es Bismarcks Bestreben, zu verhindern, daß die konstitutionelle Regierungsform unter liberalem und sozialistischem Druck von der parlamentarischen abgelöst werde. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht, eine notwendige Konzession an den Liberalismus, beschwor ständig diese Gefahr, und des Kanzlers Abhängigkeit von den Nationalliberalen verstärkte sie noch. Die Liberalen gewährten ihre Unterstützung nicht ohne Gegenleistung. Sie drängten auf Liberalisierung des Staatsapparates und auf Demokratisierung der Verwaltungslaufbahn, die immer noch weitgehend ein Monopol des Land- und Dienstadels war. Sie betrieben eine Wirtschaftspolitik, die wachsende Opposition hervorrief und die Führung der Regierungsgeschäfte komplizierte. Es tat der Stellung des Kanzlers als eines »ehrlichen Maklers« zwischen Vertretern gegensätzlicher Interessen nicht gut, daß er in Abhängigkeit zu einer einzelnen Partei geraten war. Angesichts seiner Position und der politischen Aufgaben, die er sich gesetzt hatte, mußte ihm daran liegen, daß sich im Parlament keine ständigen Mehrheiten gruppierten.
Die von der Wirtschaftskrise hervorgerufenen sozialen und politischen Spannungen ließen bald eine neue Gefahr am politischen Horizont auftauchen, die es Bismarck noch schwerer machte, seinen Kurs einzuhalten. Im Mai 1875 vereinigten sich in Gotha die beiden Hauptorganisationen der sozialistischen Arbeiterschaft – der von Lassalle 1863 in Leipzig gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die von den Anhängern von Karl Marx, insbesondere Wilhelm Liebknecht und August Bebel, 1869 in Eisenach gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei – zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (48). In den Wahlen von 1874 hatten die beiden Richtungen zwar erst neun Reichstagssitze erhalten, und ihrer Ideologie nach war die neue Partei scharf gegen die Grundsätze des bürgerlichen Liberalismus gerichtet, in der parlamentarischen Praxis aber spielte sie doch die Rolle eines Verbündeten der linken Liberalen; beide erstrebten eine parlamentarische Regierungsform. Bismarcks vordringlichste Aufgabe wurde es jetzt, seinen Obrigkeitsstaat gegen den Einbruch einer gefährlichen Koalition zu verteidigen; seine politische Strategie zielte darauf ab, die Liberalen zu schwächen und die Sozialisten zu unterdrücken.
Sozialgesetzgebung und Schutzzollpolitik, so hoffte der Kanzler, würden es der Regierung ermöglichen, sich die von der Krise verursachte allgemeine Unzufriedenheit zunutze zu machen. Staatseingriffe sollten die liberalen Vorkämpfer des Freihandels in Verlegenheit setzen und schwächen, dagegen Macht und Ansehen des christlichen Staates stärken und den Sozialdemokraten den Wind aus den Segeln nehmen. Zur Durchführung seiner Absicht aber brauchte Bismarck die Unterstützung einer ihm wohlgesinnten Reichstagsmehrheit, die er in diesem Falle nur von den Konservativen und Katholiken erhoffen konnte. Die Grundlagen für eine Koalition der beiden Parteien waren im Laufe der antisemitisch-antiliberalen Kampagne gelegt worden. Daß Bismarck persönlich dabei aufs heftigste angegriffen worden war, trübte nicht seinen Blick für die Möglichkeiten, die sich aus der Neugruppierung ergaben.
Читать дальше