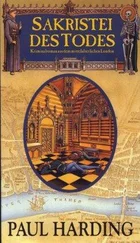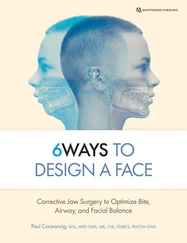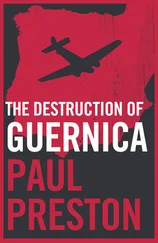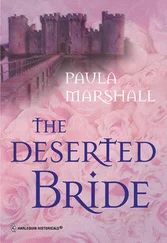Marr spricht jedoch nicht für alle Gegner der Bismarckschen Politik und der neuen kapitalistischen Gesellschaft. Er verschmäht es, die Errungenschaften der modernen Wissenschaft den Dogmen der katholischen Religion zu opfern, kann auch, wie er sagt, keinen Geschmack daran finden, sich »mit den protestantischen ›Muckern‹« zu verbinden, sondern zählt sich zu den »ehemaligen Radikalen«, die jetzt in das Lager jener Kräfte getrieben werden, die das »verjudete›liberale‹ Deutschland« als »reaktionär« zu bezeichnen pflege 24). Die Sozialdemokratische Partei erscheint ihm als »der rohe, brutale, aber vollständig unbewußte Protest gegen die realistische Verjudung der Gesellschaft« und überdies von allem Anfang an von Juden beherrscht, »wie denn ja auch der Stifter der deutschen Sozialdemokratie, Lassalle, ein Semit war« 25). Deutschland könne sich besonders schlecht gegen die jüdische Invasion wehren, weil »das Gefühl einer deutschen Nationalität, geschweige eines deutschen Nationalstolzes, in den germanischen Ländern nicht existierte« 26).
Marr grenzt sich also ab gegenüber anderen kritischen Gruppen und Kräften; er wurzelt weder im Katholizismus noch im protestantischen Konservatismus, erst recht nicht in der sozialistischen Arbeiterbewegung. Er zählt sich zu einer Elite Deutschlands, die aufgrund ihrer Bildung, Begabung und Hingabe an den nationalen Gedanken zur politischen Führung des Reiches berufen sei, aber beiseite stehen müsse, verdrängt von den »Juden und Liberalen«. Die Resignation, die er zur Schau trägt, kann kaum verbergen, wie tief ihn das Bewußtsein durchdringt, Männer von seinem Schlage seien die einzig legitimen Anwärter auf Macht und Ehre im neuen Deutschland. Selbst wenn er sich den Gegnern der gegenwärtigen Reichspolitik anbietet, zeigt er noch, daß er nicht einer von ihnen ist: »Wer uns hilft aus dem Verderben, der hat uns.« 27)
Kaum hatte Marr mit seinem »Sieg des Judenthums über das Germanenthum« den ersten Schuß abgefeuert, als ein weiterer Angriff erfolgte. 1874 veröffentlichte die Gartenlaube, die beliebteste literarische Zeitschrift des Mittelstandes, eine antisemitische Artikelserie »Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin«, die 1876/77 auch als Buch herauskam und viel Aufsehen erregte. Der Verfasser war Otto Glagau, ein talentierter politischer Journalist, der sein Vermögen in Gründerzeitspekulationen verloren haben soll (28). Er gab konkreter als Marr den Beschwerden jener Gruppen des alten Mittelstandes Ausdruck, deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung auf dem Spiel stand – der Handwerker, kleinen Unternehmer, Gewerbetreibenden, unteren Beamten und Bauern. Glagau bezichtigte jüdische Abgeordnete, besonders Lasker und Bamberger, der Verantwortlichkeit für Gesetze, durch welche Handel, Börse und die großen Unternehmen auf Kosten von Handwerk und Landwirtschaft begünstigt wurden. Seine Ansichten über Judentum, Liberalismus, Manchestertheorie, die moderne Bourgeoisie, politische Parteien überhaupt und die Rolle der großen Staatsmänner zeigen außergewöhnliche Verwandtschaft mit der späteren Gedankenwelt des Nationalsozialismus. Wir finden hier dieselbe Kritik an liberaler Wirtschaftsfrömmelei und konservativer Engstirnigkeit, dasselbe Werben um die Industriearbeiter und die Forderung nach sozialen Reformen, die fünfzig Jahre später typische Bestandteile der faschistischen Propaganda wurden. In der Beschreibung des kapitalistischen Systems benutzt Glagau jene unverkennbar marxistische Terminologie, die später bei den »linken« Nazis gängig wurde.
»Unter dem ökonomischen Liberalismus kann sich ein tüchtiger und behäbiger Handwerkerstand nicht behaupten, er wird von der Großindustrie erbarmungslos verdrängt; ebenso verdrängt der Großhändler den Kleinhändler, verschwindet mehr und mehr der Bauernstand und wird verschlungen von dem Großbesitz. Wie einst im alten Rom, so zerfällt auch im neuen Deutschen Reich der kräftige Mittelstand, und es wächst lawinenartig das besitzlose Capital.« 29)
»Das Manchestertum ist die Midaslehre vom Gelde, es will alles in Geld verwandeln, Grund und Boden, Arbeit und Menschenkraft; es feiert den Egoismus, das völlig ungebundene Walten der rohen Selbstsucht, und verwirft Gemeinsinn, Humanität und alle sittlichen Prinzipien; es predigt das Streben nach unbedingter Herrschaft des Capitals, den krassen Materialismus. Sein Grundsatz ist das berüchtigte ›Laissez faire et passer‹ … Die erste Forderung des Manchestertums ist daher: unbeschränkte Gewerbefreiheit und Freizügigkeit; damit glaubt es für den Arbeiter alles getan zu haben, aber wie dieser begriffen hat, ist es nur die Freiheit, sich die Beschäftigung und den Ort zu wählen, wo er verhungern mag. Gerade Freizügigkeit und Gewerbefreiheit versorgen den Fabrikherrn mit einem unversiegenden Strom von wohlfeilen Arbeitskräften, indem sie das platte Land entvölkern, die Städte aber überfüllen.« 30)
»Das Judentum ist das angewandte, bis zum Extrem durchgeführte Manchestertum. Es kennt nur noch den Handel, und auch davon nur den Schacher und Wucher. Es arbeitet nicht selber, sondern läßt Andere für sich arbeiten, es handelt und spekuliert mit den Arbeits- und Geistesprodukten Anderer. Sein Zentrum ist die Börse … Als ein fremder Stamm steht es dem Deutschen Volk gegenüber und saugt ihm das Mark aus. Die soziale Frage ist wesentlich Gründer- und Judenfrage , alles übrige ist Schwindel.« 31)
Die Schichten, die Glagau verteidigt, waren bisher nicht fähig gewesen, eine selbständige politische Organisation aufzubauen. Handwerker hatten es während und nach der 48er Revolution versucht, aber ihre Bestrebungen waren vereinzelt und erfolglos geblieben. Glagau erwähnt lobend ihre »sozialistische« Werbearbeit und bedauert, daß es ihnen, im Gegensatz zu den Arbeitern, nicht gelungen sei, sich zu organisieren. Daß der kleine Mittelstand Schwierigkeiten hat, sich für eine systematische politische Aktion zusammenzuschließen, ist eine weithin beobachtete Tatsache. Seine Zwischenstellung zwischen Kapital und Arbeit und seine verschieden gelagerten sozialen wie Ökonomischen Interessen erschweren die Zusammenarbeit auf lange Sicht. Solche Gruppen neigen dazu, nach einem Führer zu suchen, der nicht auf die Unterstützung der bestehenden politischen Parteien angewiesen zu sein scheint. In Zeiten akuter Spannung machen sie gern den Bonapartismus zu ihrem politischen Ideal. Die Sehnsucht nach dem starken Mann, dem »ehrlichen Makler«, der über Klassen und Parteien steht, und die Vorstellung von einem »unpolitischen« Staat durchzog die politischen Träume des deutschen Mittelstandes von Bismarck bis Hitler. Später wurde es der deutschen Gesellschaft zum Verhängnis, daß sie nicht in der Lage war, das politische Potential dieser Gruppen rechtzeitig zu erkennen und zu leiten. Der Liberalismus hatte ihnen nichts anderes zu bieten als die Weisheit des erfolgreichen Konkurrenten; die Konservativen nichts als das Lob ihrer moralischen Tugenden; die Sozialisten schoben sie, als von den »Gesetzen des Kapitalismus zum Untergang verurteilt«, beiseite. Erst dem Nationalsozialismus gelang es, sie politisch zu organisieren.
Die Verwandtschaft der Wirtschaftsphilosophie des Antisemitismus im neunzehnten Jahrhundert mit der des Nationalsozialismus liegt auf der Hand. Der Begriff »raffendes Kapital« zum Beispiel, der so prominent in der frühen Wirtschaftstheorie des Nationalsozialismus auftrat, war von den antisemitischen Schriftstellern der siebziger Jahre schon allgemein benutzt worden. Glagau, der Wortführer des Mittelstandes, gebrauchte ihn. Adolf Stoecker, der Vertreter des christlichsozialen Antisemitismus, betonte einige Jahre später, daß er ja nur das »mobile« Kapital, das »Börsenkapital« bekämpfe. »Marx und Lassalle«, sagte er, »haben das Problem nicht nach der Börse, sondern nach der Industrie hin gesucht, die Industriellen für alle sozialen Mißstände verantwortlich gemacht und den Haß der Arbeiter auf sie gelenkt. Unsere Bewegung korrigiert das in etwas: Wir zeigen dem Volk die Wurzeln seiner Not in der Geldmacht, dem Mammonsgeist der Börse.« 32) In ähnlicher Weise stellte im Dezember 1893 der antisemitische Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg im Reichstag fest, er und andere Antisemiten hätten gar nichts gegen jüdisches Kapital als solches oder gegen Kapital an sich einzuwenden. Man müsse unterscheiden zwischen »schädlichem und nützlichem Kapital«. Nützliches Kapital sei angelegt in der Landwirtschaft und »in der gesamten Industrie«, in »redlichem Handel« und »in dem Sparvermögen, das das Ergebnis eines an Arbeit reichen Lebens darstellt«. Schädliches Kapital sei das, »welches sich, ohne wirkliche Arbeit zu leisten, ins Ungemessene vermehrt« durch »Lug und Trug und Schwindel. Dieses Kapital finden wir an der Börse, und daß dieses Kapital meist ein jüdisches ist, dafür können wir doch nichts.« 33)
Читать дальше