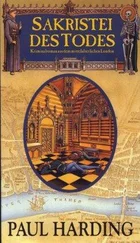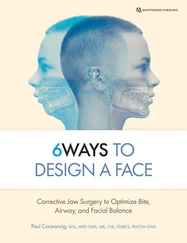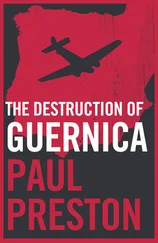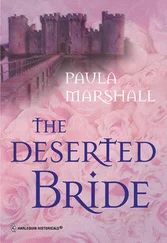In den ersten Hetzblättchen aus den Tagen des Fries und jenes Jahn, der heute bei den Fronvögten der Ostzone in hohen Ehren steht, war schon der totalitäre Antisemitismus angelegt; schon ihre Sprache wollte auf den Mord hinaus, und auch Schichten, die sich als Elite oder als Fortgeschrittene fühlten, waren, wie in Massings Buch sich zeigt, nicht gegen jenes Potential gefeit. Es überlebt, und darum ist die Analyse des Antisemitismus heute, da er nach der Ausrottung der Juden nicht gar zu offen sich vorwagt, so dringlich wie je – und die Bedingungen für ihre Aufnahme mögen günstiger sein, als wenn offener Haß die Regung der Vernunft überschreit.
Keineswegs ist der totalitäre Antisemitismus ein spezifisch deutsches Phänomen. Versuche, ihn aus einer so fragwürdigen Entität wie dem Nationalcharakter, dem armseligen Abhub dessen, was einmal Volksgeist hieß, abzuleiten, verharmlosen das zu begreifende Unbegreifliche. Das wissenschaftliche Bewußtsein darf sich nicht dabei bescheiden, das Rätsel der antisemitischen Irrationalität auf eine selber irrationale Formel zu bringen. Sondern das Rätsel verlangt nach seiner gesellschaftlichen Auflösung, und die ist in der Sphäre nationaler Besonderheiten unmöglich. In der Tat verdankt der totalitäre Antisemitismus seine deutschen Triumphe einer sozialen und ökonomischen Konstellation, keineswegs den Eigenschaften oder der Haltung eines Volkes, das von sich aus, spontan, vielleicht weniger Rassenhaß aufbrachte als jene zivilisierten Länder, die ihre Juden schon vor Jahrhunderten vertrieben oder ausgerottet hatten. In der von Massing behandelten Periode war der Antisemitismus in Frankreich – dem der Dreyfus-Affaire und Drumonts – kaum weniger virulent.
Wer den totalitären Antisemitismus begreifen will, sollte sich nicht dazu verleiten lassen, dessen Erklärung einer gleichsam naturgegebenen Notwendigkeit gleichzustellen. Wohl sieht retrospektiv alles so aus, als hätte es so kommen müssen und nicht anders sein können. Man wird unter den Berühmten der deutschen Vergangenheit bis hinauf zu Kant und Goethe nur wenige nennen können, die von judenfeindlichen Regungen ganz frei waren. Aber indem man auf solche Universalität insistiert und die Fatalität des Geschehenen im Begriff nochmals wiederholt, macht man sie in gewissem Sinn sich selbst zu eigen. Den Spuren des heraufdämmernden Verhängnisses in der deutschen Vergangenheit ist allerorten auch deren Gegenteil gesellt, und die Weisheit, ex post facto zu dekretieren, was von vornherein das Stärkere gewesen sei, macht es sich allzu leicht, indem sie das Wirkliche als das allein Mögliche unterstellt. In Frankreich hatten einige der tapfersten Dreyfusards, wie Zola und Anatole France, in ihre Romane zuweilen Darstellungen von Juden eingefügt, die jenen Klischees ähneln, gegen deren Konsequenz sie sich einsetzten. Zur Erfahrung von Geschichte gehört auch das Bewußtsein des Nichtaufgehenden, Diffusen, Vieldeutigen.
Hier vielleicht trägt Massings Buch Entscheidendes bei. Es hilft, den Knoten des Zufälligen und Notwendigen, auf selber rationale Weise, zu entwirren. Während er das amorphe, immer gegenwärtige, aber auch nie ganz wahre Potential des Judenhasses in den Bevölkerungen visiert, ohne doch daraus die Katastrophe abzuleiten, trifft seine Forschung den Bereich, an dem sich erkennen läßt, warum jenes Potential sich durchsetzte. Er zeigt an den geschichtlichen Tatsachen mit großer Evidenz, daß im Bismarckschen Deutschland der Antisemitismus politisch manipuliert und, je nach der Forderung des Tages der damaligen Interessen, an- und abgestellt wurde. Jene spontanen Volkserhebungen des Dritten Reiches, die auf ein Signal wohlorganisiert aufflammten, haben ihre Vorform in den Bewegungen der Stoecker und Ahlwardt, über die man opportunistisch verfügte, und die man mit vornehm-konservativem Gestus ebensogut zur Ruhe und Ordnung verhalten wie gegen die Sozialdemokratie loslassen konnte. Ohne daß die Rezeptivität der Masse für derlei Reize verkannt würde, ist doch zugleich auch ihr Maß an Schuld relativiert: die nach Opfern schreien, offenbaren sich als Opfer selber, als von der politischen Macht hin- und hergeschobene Schachfiguren. Der Antisemitismus hat seine Basis in objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen ebenso wie in Bewußtsein und Unbewußtsein der Massen. Aber er aktualisiert sich als Mittel der Politik: als eines der Integration auseinanderweisender Gruppeninteressen; als die kürzeste und ungefährlichste Art, von einer Lebensnot abzulenken, zu deren Beseitigung andere Mittel verfügbar wären.
Massing bleibt nicht bei dieser generellen These stehen; er behauptet sie nicht einmal. Aber an dem Material, das er in minutiöser soziologischer und historischer Arbeit zusammengebracht hat, leuchtet sie ein. Besonnene wissenschaftliche Objektivität läßt hinter sich, was irgend die polemische Phantasie auszumalen vermöchte.
Ganz besonderer Dank gebührt Dr. Felix J. Weil, dem treuen Freund des Instituts, dem es sein Dasein verdankt. Er hat nicht nur Massings Text ins Deutsche übersetzt, sondern unermüdlich an der Vorbereitung der Publikation mitgewirkt.
Frankfurt am Main
Sommer 1959
Max Horkheimer
Theodor W. Adorno
Vorwort von Paul W. Massing zur amerikanischen Ausgabe
Die vorliegende Studie befasst sich mit den historischen Vorläufern des nationalsozialistischen Antisemitismus im kaiserlichen Deutschland in der Zeit zwischen der Emanzipation der deutschen Juden und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Damit soll ein Beitrag zum Verständnis der politischen Entwicklungen geleistet werden, die schließlich im Massenmord an den Juden als Teil der deutschen nationalen Politik gipfelten. Indem wir uns auf die politischen Aspekte des Antisemitismus im deutschen Kaiserreich, auf Machtprobleme, Gruppenprivilegien und Gruppenantagonismen konzentrieren, hoffen wir auch, das Verständnis des modernen Antisemitismus generell zu fördern.
Politischer Antisemitismus ist nicht an nationale Grenzen gebunden, dennoch nimmt er seine spezifischen Züge aus einem bestimmten nationalen Umfeld. Diese Studie zum politischen Antisemitismus im kaiserlichen Deutschland umfasst daher ein weites Feld, es reicht von den politischen Parteien, über religiöse und berufsständische Organisationen, die Regierung und Opposition bis hin zu Individuen und gesellschaftlichen Gruppen. Die Behandlung des Themas in einem so breiten Rahmen bringt erhebliche Schwierigkeiten bei der Auswahl und Bewertung mit sich. Es besteht die Gefahr, zu wenig und zu viel zu geben. Das komplexe historische Bild kann leicht verzerrt werden, wenn die Aufmerksamkeit auf ein einziges seiner Merkmale gerichtet wird. Es gab nicht nur Antisemitismus in Deutschland. Darüber hinaus mussten bedeutende und positive Phasen des intellektuellen, kulturellen und sogar politischen Lebens in Deutschland vernachlässigt oder ganz ausgelassen werden, wenn sie keinen Bezug zum spezifischen Problem zu haben schienen; es wurde nicht versucht, eine umfassende Darstellung der Zeit zu geben. Andererseits ist das Phänomen derart, dass es nicht aus dem gesellschaftspolitischen Gefüge des deutschen Lebens herausgelöst werden kann. Das Verständnis des deutschen Antisemitismus erfordert ein Verständnis der deutschen Gesellschaft.
Das moderne Deutschland war nie in der Lage, eine bürgerliche Gesellschaft nach dem Vorbild des westlichen Liberalismus zu entwickeln. Die Tatsache, dass Deutschland nie einen radikalen Bruch mit seiner feudalen Vergangenheit vollzog, war der wichtigste Einzelfaktor, der den Verlauf seiner Geschichte bestimmte. Lange nachdem England und Frankreich nationale Einheit, demokratische Regierungen und imperiale Besitzungen erreicht hatten, lange nachdem das Bürgertum zum Zentrum des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens dieser Länder geworden war, blieb Deutschland wirtschaftlich rückständig und politisch unterentwickelt, mit einem Bürgertum, das zu schwach war, die Macht zu übernehmen und die Nation neu zu gestalten, wie es das französische und englische Bürgertum getan hatte. Während der gesamten Existenz des kaiserlichen Deutschlands blieben die alten aristokratischen Kreise an der Macht. Im Kampf um den Erhalt ihrer Position erhielten sie Unterstützung von den großen vorbürgerlichen Schichten zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft, die die deutsche Soziologie gewöhnlich als den alten Mittelstand bezeichnet. Die alten aristokratischen Machthaber und der alte Mittelstand teilten eine Antipathie gegen den vom Bürgertum geförderten Liberalismus, und alle diese Schichten zusammen teilten die Angst vor dem Aufstieg der Arbeiterschaft. Der Antisemitismus wurde Teil der daraus resultierenden gesellschaftspolitischen Konstellation.
Читать дальше