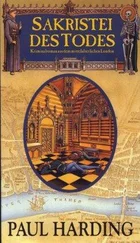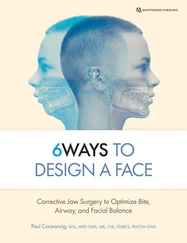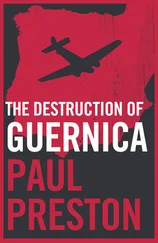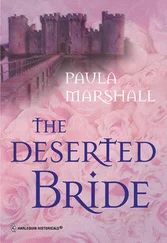In der Geschichte des Antisemitismus in Deutschland vermischen sich daher auf merkwürdige Weise Elemente der Reaktion im herkömmlichen Sinne des Wortes mit Elementen der sozialen Rebellion. Die nationalistische Verherrlichung der deutschen Vergangenheit und die Ablehnung der „erwerbsorientierten“ oft als jüdisch stigmatisierten westlichen Gesellschaft 1sind mit dem Antisemitismus als Manifestation des gesellschaftlichen Protests verbunden. Bereits in der Zeit der preußischen ‚Befreiungskriege' gegen Napoleon wurde der Judenhass mit Idealen von Freiheit und Unabhängigkeit verbunden. Mit der demokratischen Revolution von 1848 kam es zum Aufflammen eines populären Antisemitismus. 2Ein Flugblatt, das damals in Baden kursierte, verkündete als Ziele der Revolution die Vernichtung der Aristokratie, die Vertreibung der Juden aus Deutschland, die Absetzung aller Könige, Herzöge und Fürsten und die Ermordung aller Regierungsbeamten. Es erklärte, dass „Deutschland ein Freistaat wie Amerika werden“ muss. 3
Nicht selten fanden die Einebnung von Schlössern und die Plünderung von jüdischen Häusern gemeinsam statt. In den 1880er Jahren organisierte ein Sozialreformer die hessischen Bauern auf der Basis von Antisemitismus und ländlichen Genossenschaften, und in den 1890er Jahren trugen antisemitische Agitatoren den Kampf gegen den Landadel in das Territorium der Junker.
Die doppelte Natur des Antisemitismus als politisches Mittel und als verworrener Ausdruck sozialen Protests mag einige der populären Missverständnisse über seine Rolle in der modernen deutschen Geschichte erklären. Die herrschenden Gruppen haben das Instrument nicht ununterbrochen eingesetzt. Es gab Zeiten, in denen sie, und mit ihnen die Mehrheit des deutschen Volkes, die Judenhetze als unverantwortlich und ungehobelt ansahen und ihren Protest gegen die Verfolgung der Juden in anderen europäischen Ländern zum Ausdruck brachten. In den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg war der organisierte Antisemitismus in Deutschland auf dem Rückzug. Die Erinnerung an diese Jahre hat den Irrglauben begünstigt, dass der deutsche Antisemitismus vor dem Aufstieg der NS-Bewegung vernachlässigbar war. Tatsache ist, dass es in Deutschland Bewegungen gab, die den Kampf gegen Juden zum Hauptbestandteil ihrer Aktivitäten machten, lange bevor Hitler an die Macht kam. Gemessen an der Zahl ihrer Anhänger, ihrer organisatorischen Stärke oder ihrer politischen Vertretung erreichten die Antisemiten vor Hitler jedoch nie den Status großer politischer Parteien. Aber ihre Bedeutung kann nicht allein nach solchen Kriterien beurteilt werden. Sie hielten den Antisemitismus in der deutschen Kultur lebendig und verbreiteten ihn. Sie formulierten die rassistische Ideologie lange vor der Entstehung des Nationalsozialismus und halfen, den Weg für eine politische Allianz gesellschaftlicher Kräfte zu ebnen, die sich als tödlich für die deutsche Republik und katastrophal für die Welt erwies.
Dass der Antisemitismus zeitweise so unverkennbar eine Manifestation des sozialen Protests war, führte zu einer weiteren falschen Einschätzung seiner möglichen Funktion. Noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts waren liberale Historiker und sozialistische Autoren davon überzeugt, dass antisemitische Agitation nichts anders könne, als die politischen Interessen schlummernder gesellschaftlicher Gruppen zu wecken, die sich, einmal zum politischen Denken erweckt, bald den Kräften des Fortschritts anschließen würden. Die Auswirkungen der jüngsten Geschichte sollten die letzten Reste solcher Illusionen vertrieben haben.
Allerdings könnte das Pendel wieder zu weit ausgeschlagen haben. Die Ereignisse des letzten Jahrzehnts haben den Glauben bestärkt, Deutschland sei ein Einzelfall. Das war es sicherlich. Aber wir würden die Theorien der Nationalsozialisten über den deutschen ‚Volksgeist‘ ernster nehmen, als diese es selbst taten, wenn wir den Antisemitismus auf einen angeborenen deutschen Charakter zurückführen würden. Die Nationalsozialisten sahen an dem ‚einheimischen‘ Produkt genügend Möglichkeiten es zu exportieren.
Genauso wie der Antisemitismus eines Individuums komplexeste psychologische Funktionen haben kann, kann der politische Antisemitismus in einer Vielzahl von Konfliktsituationen dienen. Die Geschichte zeigt, wie er in der einen oder anderen Zeit von klerikal-feudalen Interessen gegen den säkularen Liberalismus, von Regierungen gegen die Opposition, von der Reaktion gegen die Arbeiterschaft, von imperialistischen Kräften gegen die Völker begehrter Gebiete oder auch vom nationalistischen Widerstand gegen ausländische Interventionen eingesetzt wurde. Aber die Geschichte zeigt auch die Kräfte, die sich ihm widersetzten, und die Umstände, die sein Wachstum behinderten. Jede fruchtbare Analyse des Phänomens muss daher konkret und sensibel für seine vielfältigen und oft widersprüchlichen Erscheinungsformen sein.
Das vorliegende Buch habe ich als Mitglied des Institute of Social Research, New York, geschrieben, und ich bin dem Direktor des Instituts, Dr. Max Horkheimer, zu großem Dank verpflichtet, der die Idee dazu hatte und mich während der gesamten Zeit des Schreibens beriet. Andere Mitglieder des Instituts, Dr. Leo Löwenthal, Dr. Friedrich Pollock, Dr. Felix J. Weil und Dr. Karl A. Wittfogel, haben das Manuskript in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gelesen, und ich habe mich frei auf ihr Wissen und ihre Erfahrung gestützt. Dr. A. R. L. Gurland hat mir mit seiner strengen und konstruktiven Kritik sehr geholfen. Mit einem besonderen Gefühl der Verpflichtung danke ich Herrn Georg Fuchs für seine unermüdliche Hilfe. Seine Kenntnisse der deutschen Gesellschaft und Politik und seine Leidenschaft für das Verständnis der Entwicklung der jüngsten deutschen Geschichte waren eine ständige Quelle der Inspiration. Dr. John Slawson, Executive Vice-President des American Jewish Committee, und Dr. Samuel H. Flowerman, Direktor der wissenschaftlichen Abteilung des Komitees, bin ich dankbar, dass sie viel Geduld mit dem Zaudern des Autors gezeigt haben. Es ist mir ein Anliegen, auch Frau Lore Kapp und Frau Nina Rubinstein für die Unterstützung bei der Recherche und Frau Edith Kriss für die Vorbereitung des Manuskripts meinen Dank auszusprechen. Die Herren Herbert und William Poster bearbeiteten das Manuskript. Herr John I. Shields erstellte den Index. Herr Heinz Norden übersetzte die Dokumente I-XI und Frau Fiorella Haas vom American Jewish Committee das Dokument XII. Ich möchte ihnen allen für ihre Hilfe danken.
Paul W. Massing
Rutgers University
New Brunswick, New Jersey
15. September 1949
Aus dem Amerikanischen
von Ulrich Wyrwa
1Johann Gottlieb Fichte, Der geschlossene Handelsstaat, Tübingen 1800, S. 286: „Sie erfreut mehr die List des Erstrebens, als die Sicherheit des Besitzes. Diese sind es, die unablässig nach Freiheit rufen, nach Freiheit des Handels und Erwerbes, Freiheit von Aufsicht und Polizei, Freiheit von aller Ordnung und Sitte.“
2Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte, 12 Bde., Berlin 1920–1922, Bd. 10, S. 481.
3Veit Valentin, Geschichte des Deutschen Revolution von 1848–1849, 2 Bde., Berlin 1930, Bd. 1, S. 344–5.
KAPITEL I
Die Liberale Ära (1871-1878)
Wie in anderen europäischen Ländern, so bildete auch in Deutschland der Kampf um die politische Emanzipation der Juden einen Teil des umfassenderen Kampfes zwischen den alten Feudalmächten und dem aufsteigenden Bürgertum. Erfolge und Mißerfolge der Juden in ihrem Ringen um bürgerliche Gleichberechtigung hingen aufs engste zusammen mit dem Schicksal des deutschen Liberalismus in seinem Streben nach Demokratie und nationaler Einheit. Das Emanzipationsgesetz selbst wurde erst 1869 vom Norddeutschen Bund angenommen. Aber schon in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hatte Deutschland auf seinem Wege zur Verstädterung und Industrialisierung den Juden wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vorteile geboten, die ihnen in östlichen und südöstlichen Ländern Europas versagt blieben. Von 1816 bis 1848, also vom Ende der Napoleonischen Kriege bis zur Revolution, stieg die Zahl der jüdischen Bevölkerung von 300 000 auf 400 000. Jüdische Namen hatten Klang in Handel und Bankwesen, in Literatur und Politik. Eduard Simson, ein getaufter Jude und Professor der Rechte, wurde im Oktober 1848 Vizepräsident, im Dezember Präsident der Frankfurter Nationalversammlung. In der Periode der politischen Reaktion hingegen, die der Niederlage der Revolution folgte, sahen die Juden ihre bürgerlichen Rechte von fast allen deutschen Staaten wieder beschnitten.
Читать дальше