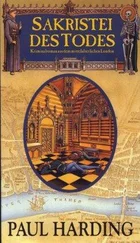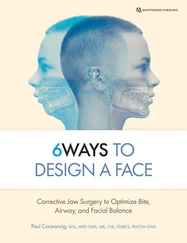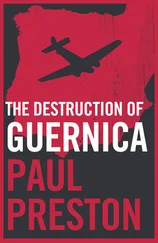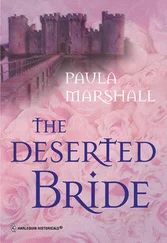1 ...8 9 10 12 13 14 ...23 Stoecker nahm wirklich »den wilden Stier bei den Hörnern« in einer Massenversammlung, die in der Geschichte seiner Berliner Bewegung eine ähnliche Rolle spielt wie die erste Hitlersche Massenversammlung in München in der Geschichte der Nazibewegung (53a). Als Hauptredner war ein gewisser Emil Grüneberg angekündigt. Diesen Grüneberg, einen ehemaligen Schneider, hatte der Geschäftsführer der Berliner Stadtmission als einen augenscheinlich bekehrten Sozialdemokraten zu Stoecker geschickt. Stoecker, der für seinen Feldzug gegen die Sozialdemokratische Partei nach geeigneten Helfern suchte, nahm Grüneberg gern in Dienst, obwohl er über seinen zweifelhaften Charakter und seine Vorstrafen Bescheid wußte. Nach dem Polizeibericht war Grüneberg als sozialistischer Agitator Wohlhabende um Geld angegangen und aus der Sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen worden; zweimal saß er im Gefängnis, zuerst wegen Majestätsbeleidigung, dann wegen Bettelei. Aber das hinderte den Hofprediger nicht, sich seiner zu bedienen (54). »Ohne einen Mithelfer aus den Arbeiterkreisen hätte ich die Sache nicht anfangen können«, bemerkte Stoecker nachträglich 55).
Die Männer, die in den Eiskellersaal kamen, um Grüneberg zu hören, waren größtenteils Sozialdemokraten. Unter ihnen befand sich der Reichstagsabgeordnete Johann Most, einer der besten Redner der Partei und bekannt für seinen streitbaren Atheismus 56). Die Sozialdemokraten bemächtigten sich sogleich der Versammlungsleitung, gewährten aber Redefreiheit. Grünebergs frömmelnde Plattheiten erregten nur Gelächter. Die Versammlung war nahe daran, statt zur Wiege der Christlichsozialen Arbeiterpartei ihr Grab zu werden. Da ergriff Stoecker das Wort. Seine Rede zeigte sofort, daß er auch eine feindselige Zuhörerschaft aufmerksam machen konnte. Er sprach zunächst von seiner eigenen niedrigen Herkunft; obwohl er jetzt den hohen Rang eines Hofpredigers habe, sei er doch selber aus der Welt der Arbeit gekommen und kenne ihr Elend. Dann beschrieb er die unheilvollen Auswirkungen der wirtschaftlichen Depression auf das Leben der Arbeiter und griff den Kapitalismus an, »diese Herrschaft der schrankenlosen Konkurrenz und des krassesten Egoismus«, die »von Krisis zu Krisis« führe. Als Abhilfe verlangte er soziale Reformen: Fürsorge für Arbeitsunfähige, Beschränkung der Frauen- und Verbot von Sonntagsarbeit. Schließlich drängte er die Arbeiter, seiner neuen Organisation beizutreten:
»Ich denke dabei an eine friedliche Organisation der Arbeit und der Arbeiter; ist diese geschaffen, dann kann man gemeinsam beraten und erstreben, was not tut. Aber das ist Ihr Unglück, meine Herren, Sie haben Ihren Sozialstaat im Kopfe. Und wenn man Ihnen die Hand bietet zu Verbesserungen, wenn man Ihnen helfen will, dann weisen Sie das höhnisch zurück und sagen: Wir sind mit nichts zufriedenzustellen, wir wollen den Sozialstaat. Damit verfeinden Sie sich die anderen Klassen, und der Haß verdirbt alles.
Ja, meine Herren, Sie hassen Ihr Vaterland. Aus Ihrer Presse glüht dieser Haß schrecklich heraus. Und das ist schlecht; das Vaterland hassen, das ist, wie wenn einer seine Mutter haßt. Auch haben Sie dazu keinen Grund. Gewiß ist auch bei uns nicht alles, wie es sein sollte; wir sind eben auf der Erde und nicht im Himmel. Aber dazu hat Ihnen das deutsche Reich das allgemeine Stimmrecht aus freien Stücken gegeben, damit Sie in Frieden mit den andern beraten und beschließen, was zum Besten dient. Nicht dazu dürfen Sie Ihr Recht mißbrauchen, daß Sie auf Zertrümmerung Ihres Vaterlandes sinnen, das ist unvernünftig und undankbar. Aber Sie hassen auch das Christentum, Sie hassen das Evangelium von der Gnade Gottes. Man predigt Ihnen Unglauben, man lehrt Sie den Atheismus und Sie trauen den falschen Propheten …« 57)
Ein Sozialdemokrat, der sich auf dieser Versammlung zu der neuen politischen Anschauung bekehrte, schrieb später seine Eindrücke nieder. Die Zuhörer, berichtete er, wurden unruhig während Stoeckers Rede, bewahrten aber Disziplin und ließen ihn ausreden. Dann begann Johann Most unter wildem Beifall eine heftige Ansprache, in der er das Christentum angriff und die Geistlichkeit der Unterwürfigkeit vor den Ausbeutern bezichtigte.
Mit großer Mehrheit nahm die Versammlung einen Beschluß an, der die »christlichsozialen« Vorschläge zurückwies. Er lautete:
»In Erwägung, daß ein fast 1900 Jahre währendes Christentum nicht im Stande gewesen ist, das Elend, die äußerste Not der überwiegenden Mehrheit der Menschheit zu lindern, geschweige denn ihnen ein Ende zu machen; in fernerer Erwägung, daß die heutigen Diener der Kirche keine Miene machen, das seither von ihnen beobachtete Verfahren zu ändern; in schließlicher Erwägung, daß selbst jede wirtschaftliche Errungenschaft, sei sie groß oder klein, völlig ohne den gleichzeitigen unbeschränkten Besitz politischer Freiheit wertlos ist, und selbst bei Erfüllung des christlichsozialen Programms die Sache beim alten bleibt, dekretiert die Versammlung, daß sie lediglich und allein von der sozialdemokratischen Partei eine gründliche Beseitigung aller herrschenden politischen und wirtschaftlichen Unfreiheiten erhofft, und daß es ihre Pflicht ist, mit allen Kräften für die Lehren dieser Partei einzutreten und dafür zu wirken.« 58)
Stoecker ließ sich durch den anfänglichen Mißerfolg nicht entmutigen, sondern fuhr fort, eine Reihe wöchentlicher Versammlungen einzuberufen; schließlich wurde »auf dem Boden des christlichen Glaubens und der Liebe zu König und Vaterland« seine Partei organisiert. Sie lehnte die Sozialdemokratie als »unpraktisch, unchristlich und unpatriotisch« ab, befürwortete »eine friedliche Organisation der Arbeiter, um in Gemeinschaft mit den anderen Faktoren des Staatslebens die notwendigen praktischen Reformen anzubahnen«, und sah ihr Ziel in der »Verringerung der Kluft zwischen reich und arm« und in der »Herbeiführung einer größeren ökonomischen Sicherheit« (59).
War das Programm der neuen Partei auch zusammengestückelt, so hatte es doch seine innere Logik. Es mußte radikal genug sein, um Arbeiter von der Sozialdemokratie wegzulocken, durfte sich aber andererseits wichtige Mächte in Staat, Regierung und Wirtschaft nicht zu Gegnern machen. An peinlichem Befremden und offener Warnung vor den Folgen seiner Tätigkeit fehlte es Stoecker nicht; er klagte oft über die mangelnde Einsicht seiner konservativen Freunde. Das sensationelle Ereignis, daß ein Hofprediger am Getümmel politischer Agitation teilnahm, mußte natürlich mancherlei Kritik hervorrufen. Die Würde des Thrones drohte in Mitleidenschaft gezogen zu werden, und die evangelische Kirche fürchtete, man könne sie in kritischen sozialpolitischen Fragen auf eine Stellungnahme festlegen, die nicht mit der Billigung konservativer Kreise rechnen durfte. Außerdem betrachteten die Konservativen die Gründung dieser neuen Partei als Verletzung ihrer traditionellen Interessen.
Um das Mißtrauen seiner konservativen Freunde zu beschwichtigen, mußte Stoecker ihnen vor Augen führen, welch bedrohliche Folgen die Einführung des Systems der allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen im Reich mit sich bringen könne. In Preußen war seit der Gegenrevolution 1849/50 der überwiegende Einfluß der Konservativen immer noch zweifach gesichert, durch die feudale Zusammensetzung der oberen Kammer des Landtages – des Herrenhauses – und durch das indirekte »Drei-Klassen-Wahlrecht« zum Abgeordnetenhaus (60).
Wollten aber die Konservativen ihren Einfluß außerhalb Preußens ausdehnen und ihre Macht im Reich befestigen, wo das gleiche Wahlrecht für die männliche Bevölkerung herrschte, so gab es dafür nur einen Weg: die Partei des landbesitzenden preußischen Adels, der Hofkreise, der Armee und der protestantischen Hierarchie mußte eine Massenpartei im Reich werden. Das erforderte manche Konzessionen, die den eingefleischten Konservativen mit ihrer tiefverwurzelten Abneigung gegen demokratische »Pöbelherrschaft« höchst widerwärtig waren. Aber selbst wenn sie sich bereit gefunden hätten, ihrer Partei ein demokratischeres Gesicht zu geben, wäre es den Konservativen nicht leicht gefallen, die neue Rolle als Freunde der unteren Stände zu spielen. Die Erinnerung an 1848 und die nachfolgende Reaktionszeit war noch zu lebendig. Stoecker bestand daher auf der Bildung einer eigenen Organisation, die zwar in Freundschaft und Bündnis mit den Konservativen operieren, aber doch unabhängig bleiben sollte in ihrem Bestreben, der Sozialdemokratie eine christliche Arbeiterpartei entgegenzustellen und ein Sammelbecken für die »wertvollen Elemente in der Welt der Arbeit« zu bilden.
Читать дальше