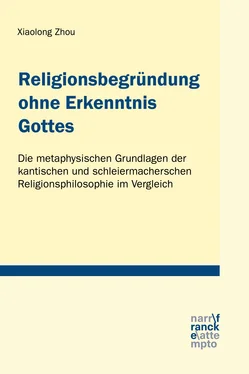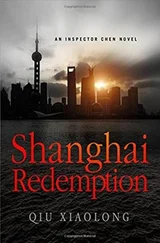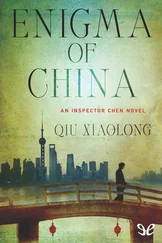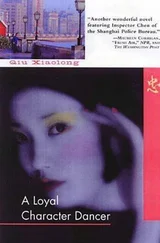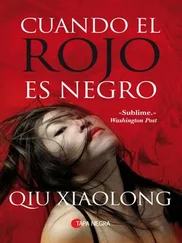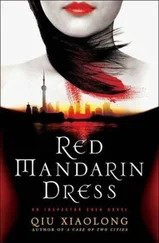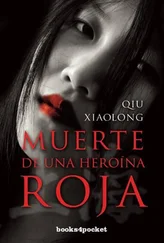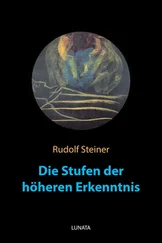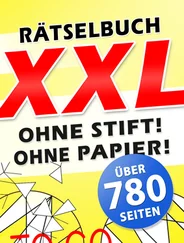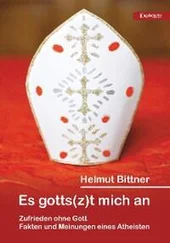Neben den vorkritischen Texten und der nachgelassenen Vorlesung können wir auch an die KrV erinnern. Im siebten Abschnitt beschreibt Kant die unterschiedlichen Theologien: „Die erstere ( theologia rationalis ) denkt sich nun ihren Gegenstand entweder bloß durch reine Vernunft vermittelst lauter transzendentaler Begriffe ( ens originarium , realissimum , ens entium ) und heißt die transzendentale Theologie, oder durch einen Begriff, den sie aus der Natur (unserer Seele) entlehnt, als die höchste Intelligenz und müßte die natürliche Theologie heißen. Der, so allein eine transzendentale Theologie einräumt, wird Deist, der, so auch eine natürliche Theologie annimmt, Theist genannt. Der erstere gibt zu, daß wir allenfalls das Dasein eines Urwesens durch bloße Vernunft erkennen können, wovon aber unser Begriff bloß transzendental sei, nämlich nur als von einem Wesen, das alle Realität hat, die man aber nicht näher bestimmen kann. Der zweite behauptet, die Vernunft sei im Stande, den Gegenstand nach der Analogie mit der Natur näher zu bestimmen, nämlich als ein Wesen, das durch Verstand und Freiheit den Urgrund aller anderen Dinge in sich enthalte.“14 Hier drückt Kant eine ähnliche Meinung wie in der Vorlesung über Rationaltheologie aus. Es gibt für Kant also zwei verschiedene rationale Theologien, die sich dadurch voneinander unterscheiden, dass diese ihren Gegenstand mit dem aus der Erfahrung entstehenden Begriff (die höchste Intelligenz) bestimmt, jene mittels lauter transzendentaler Begriffe ( ens originarium, realissimum, ens entium ). Außerdem wird die transzendentale Theologie hier von Kant kritisiert, weil seine eigene Moraltheologie samt der Physikotheologie zur natürlichen Theologie gehört.
Aus den vorkritischen, kritischen und nachgelassenen Texten kann zusammenfassend gesagt werden, dass mindestens zwei verschiedene Methoden bestehen, um Gott zu denken und zu bestimmen, nämlich eine transzendentale und eine aposteriorische, die aufgrund der Analogie Gott als die höchste Intelligenz bestimmt, während jene Gott als das ens realissimum erschließt. Ich möchte dazu anmerken, dass hier nicht gesagt wird, dass Kant das Dasein Gottes auf transzendentale und aposteriorische Weise beweist, wie er es im Beweisgrund getan hat. Was hier im Zentrum der Diskussion steht, ist, wie Kant die Erkenntnis der Eigenschaften Gottes erhält und ob er die Gewissheit der Existenz Gottes dadurch bestimmen kann.
1.2 Die transzendentale Methode
In der Transzendentalen Dialektik der KrV gibt es mindestens drei Möglichkeiten, die Idee Gottes abzuleiten. Die Reihenfolge, in der sie im Text erscheinen, lautet folgendermaßen: (1) Im System der transzendentalen Ideen zeigt Kant, dass der disjunktive Vernunftschluss, der auf die absolute Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt zielt, „den höchsten Vernunftbegriff von einem Wesen aller Wesen notwendiger Weise nach sich ziehen müsse“,1 und dieser Vernunftbegriff ist die Idee Gottes. Dementsprechend folgen aus den kategorischen und hypothetischen Vernunftschlüssen jeweils die Ideen der absoluten Einheit des denkenden Subjekts und des schlechthin Unbedingten in einer Reihe gegebener Bedingungen. Diese drei Ideen bilden die drei Hauptstücke der Transzendentalen Dialektik. (2) Bei der Thesis der vierten Antinomie schließt die Vernunft auf das schlechthin Unbedingte in einer Reihe gegebener Bedingungen, das das schlechthin notwendige Wesen ( ens necessarium ) bzw. Gott ist. Nach der Untersuchung Dieter Henrichs besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem hier genannten Gott und dem im 3. und 5. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes beschriebenen kosmologischen Beweis, jedoch nicht ohne Differenz.2 (3) Im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes bestimmt Kant, ausgehend vom Prinzip der durchgängigen Bestimmung, Gott als das ens realissimum . Allerdings ist die Rolle, die diese drei verschiedenen Weisen, die Idee Gottes abzuleiten, spielen, gänzlich unvergleichbar. Die erste Weise bindet die rationale Psychologie, die rationale Kosmologie und die transzendentale Theologie in ein System durch die kategorischen, hypothetischen und disjunktiven Vernunftschlüsse; allerdings hat diese Weise fast keine Wirkung in der folgenden Diskussion, obwohl Kant an eine innere Einheit zwischen ihr und der dritten Weise glaubt.3 Gleichzeitig kritisiert Kant die zweite Weise nicht nur in seiner Darstellung der vierten Antinomie, sondern auch im Theologie-Hauptstück. Im Gegensatz zur ersten und zweiten Weise spielt die dritte eine wichtige maßgebliche Rolle für die Idee Gottes bei Kant. Das ens realissmum als ein transzendentales Ideal repräsentiert nun Kants eigene charakteristische Idee Gottes und wird von den Forschern kontrovers diskutiert. Außerdem ist es auch der Kernbegriff des Theologie-Hauptstückes. So kommentiert Joseph Schmucker: „Denn das transzendentale Ideal wird hier von Kant ausdrücklich als entscheidendes Kriterium jeder Theologie, insbesondere auch der ihm vorschwebenden Moraltheologie anerkannt und gefordert.“4 Kant wird nicht müde zu betonen, dass dieses Ideal nicht realisiert, hypostasiert, personifiziert werden dürfe.5 Aufgrund dessen kritisiert er die drei traditionellen Gottesbeweise. In seiner vorkritischen Zeit gibt es außerdem eine Realisierung, Hypostasierung und Personifizierung dieses Ideals vom enti realissimo im kantischen ontotheologischen Gottesbeweis. Deswegen gilt die Kritik an den traditionellen Gottesbeweisen auch als eine Selbstkritik seines ontotheologischen Beweises.
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit diesem Ideal. Er versucht zu entwickeln, wie Kant endlich das ens realissimum als Gott begreift und wird folgendermaßen gegliedert: In Unterabschnitt 1.2.1 werde ich den 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes rekonstruieren, jedoch den Inhalt auf den Prozess der Erreichung dieses Ideals beschränken und die Kritik an der Realisierung, Hypostasierung und Personifizierung auf das 2. Kapitel verschieben. Nach der Rekonstruktion werde ich in Unterabschnitt 1.2.2 die wichtigsten Eigenschaften des entis realissimi mit Hilfe der Vorlesung über Rationaltheologie analysieren.
1.2.1 Gott als das „ens realissimum“
Ich lenke zunächst meine Aufmerksamkeit auf den Abschnitt Von dem transzendentalen Ideal des Theologie-Hauptstückes. In diesem Abschnitt (insbesondere in den Paragraphen 1–15) beschreibt Kant vom Prinzip der durchgängigen Bestimmung aus das ens realissimum , das transzendentale Ideal, als den Gegenstand der transzendentalen Theologie. Dies kann als Fortsetzung und Umwandlung des ontotheologischen Beweises vom Sein Gottes in der vorkritischen Zeit verstanden werden.1 Wir folgen hier dem Vorschlag von Giovanni B. Sala, den Prozess der Herleitung der Idee von Gott in drei Schritte zu unterteilen: (1) Vom Prinzip der durchgängigen Bestimmung zum Inbegriff aller möglichen Prädikate als transzendentale Voraussetzung; (2) den Inbegriff aller möglichen Prädikate zur Idee von einem All der Realität zu verfeinern. (3) Die Idee von einem All der Realität ist die Idee des entis realissimi und der Gottesbegriff im transzendentalen Sinn.2 Ich werde diese drei Schritte im Folgenden näher betrachten:
(1) Kant weist darauf hin, dass alle Dinge zum Prinzip der durchgängigen Bestimmung gehören: „nach welchem ihm von allen möglichen Prädikaten der Dinge, so fern sie mit ihren Gegentheilen verglichen werden, eines zukommen muß.“3 Für Kant hat jedes reale Prädikat sein negatives Gegenteil, z. B. licht zu finster, gut zu böse usw. Außerdem steht jedes Wesen zwischen absoluter Realität und absoluter Negation (dem Nichts), nämlich, jedes Seiende ist partim realia, partim negativa , genau wie Kant in der Vorlesung über Rationaltheologie sagt:
Читать дальше