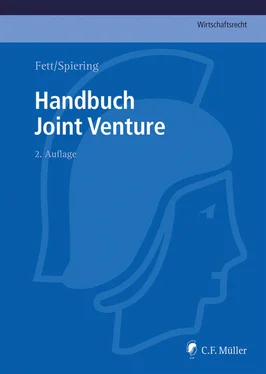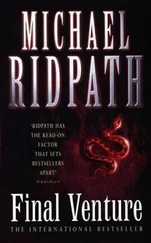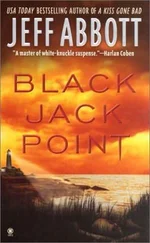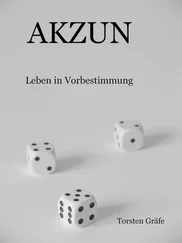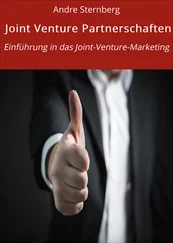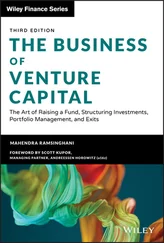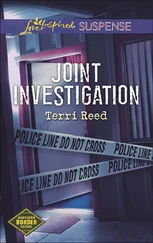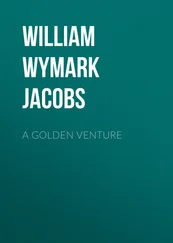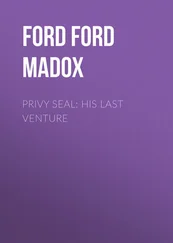Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Kapitel Einleitung
I. Begriff und geschichtliche Entwicklung
II. Wirtschaftliche Ziele der Parteien
III. Typische Spannungslagen
IV. Compliance im Joint Venture
2. Kapitel Erscheinungsformen des Joint Venture
I. Contractual Joint Venture
II. Equity Joint Venture
1. Binnenstruktur des Equity Joint Venture
2. Alternativen zum Equity Joint Venture
2.1Abgrenzung zum Contractual Joint Venture
2.1.1 Gesellschaftsrechtliche Kontrolle
2.1.2 Haftungsbegrenzung
2.1.3 Kapitalbindung
2.1.4 Corporate Identity
2.1.5 Abgrenzung der Einlagen und der Gewinnverteilung
2.1.6 Beendigung
2.1.7 Zugriff auf Vermögensgegenstände
2.1.8 Finanzierung
2.1.9 Vertraulichkeit
2.1.10 Handelsvertreter, Vertriebspartner, Lizenzvergabe
2.2 Abgrenzung zum Beteiligungskauf
2.3 Abgrenzung zur Wagniskapitalfinanzierung
3. Ausgestaltung der Zusammenarbeit
3.1 Gründung einer neuen Gesellschaft
3.2 Beteiligung an einem Tochterunternehmen des Partners
3.3 Gemeinschaftlicher Neuerwerb eines bestehenden Unternehmens
III. Operative Joint Venture, Holdinggesellschaften und Mischformen
IV. Mehrheits-Joint Venture oder paritätisches Joint Venture
V. Horizontale und vertikale Joint Venture
VI. Vollfunktions- und Teilfunktions-Joint Venture
VII. Konzentrative und kooperative Joint Venture
3. Kapitel Steuerrechtliche Behandlung von Joint Venture
I. Grundlagen
1. Begriffsabgrenzung
2. Berücksichtigung nicht steuerlicher Faktoren
3. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
II. Gestaltungsziele bei Joint Venture aus steuerlicher Sicht
1. Überblick
2.Gestaltungsmöglichkeiten
2.1 Wahl des Standorts der Joint Venture Gesellschaft
2.2 Wahl der Rechtsform der Joint Venture Gesellschaft
2.3 Steuerliche Überlegungen bei der finanziellen Ausstattung der Joint Venture Gesellschaft
III. Steuerliche Behandlung von inländischen Joint Venture Gesellschaften
1.Inländische Joint Venture Personengesellschaft
1.1 Allgemeines
1.2 Steuerbelastung bei der Errichtung
1.3 Laufende Besteuerung
1.4 Verlustberücksichtigung
1.5 Finanzierungsmöglichkeiten
1.6 Steuerbelastung bei der Beendigung
1.7 Joint Venture Personengesellschaft im Inland aus der Sicht eines ausländischen Joint Venture Partners
2.Joint Venture Kapitalgesellschaft in Deutschland
2.1 Allgemeines
2.2 Steuerbelastung bei der Errichtung
2.3 Laufende Besteuerung
2.4 Verlustberücksichtigung
2.5 Finanzierungsmöglichkeiten
2.6 Steuerbelastung bei der Beendigung
2.7 Joint Venture Kapitalgesellschaft im Inland aus der Sicht eines ausländischen Joint Venture Partners
3. Zwischenergebnis
IV. Steuerliche Behandlung von ausländischen Joint Venture Gesellschaften
1.Ausländische Joint Venture Personengesellschaft
1.1 Allgemeines
1.2 Steuerbelastung bei der Errichtung
1.3 Laufende Besteuerung
1.4 Verlustberücksichtigung
1.5 Finanzierungsmöglichkeiten
1.6 Steuerbelastung bei der Beendigung
2.Ausländische Joint Venture Kapitalgesellschaft
2.1 Allgemeines
2.2 Steuerbelastung bei der Errichtung
2.3 Laufende Besteuerung
2.4 Verlustberücksichtigung
2.5 Finanzierungsmöglichkeiten
2.6 Steuerbelastung bei der Beendigung
3. Zwischenergebnis
V. Schlussfolgerungen für die Steuerstrategie
4. Kapitel Bilanzielle Aspekte von Joint Venture in der deutschen und internationalen Rechnungslegung
I. Grundlagen
1. Bilanzierung und Aktualität von Joint Venture aus deutscher Sicht
2. Erscheinungsformen von Joint Venture
2.1 Contractual Joint Venture
2.2 Equity Joint Venture mit Beispielen aus der Praxis
3. Terminologie und Eingrenzung der Untersuchung
II. Grundlagen der Bilanzierung von Joint Venture nach HGB und IFRS
1. Überblick über die Bilanzierungsmethoden
2.Die Bilanzierungsmethoden im Vergleich
2.1 Grundzüge der Quotenkonsolidierung
2.2 Grundzüge der Equity-Methode
2.3 Bilanzpolitische Wirkungen der beiden Bilanzierungsmethoden
3.Bilanzierung von Joint Venture nach HGB
3.1 Bilanzierung auf Ebene des Gemeinschaftsunternehmens
3.2 Bilanzierung im Abschluss des Partnerunternehmens
4.Bilanzierung von Joint Arrangement in der Internationalen Rechnungslegung
4.1Neuregelung durch IFRS 11 seit 2013
4.1.1 Allgemeine Gründe und Ziele für Neuregelungen
4.1.2 Projektspezifische Zielsetzungen
4.1.3 Entwicklungs- und Einführungsphase des IFRS 11
4.1.4 Rechnungslegungsstandard IFRS 11 im Überblick
4.2 Klassifizierung von Joint Arrangement nach IFRS 11
4.2.1 Merkmale von Joint Arrangement
4.2.2 Klassifizierung als Joint Operation oder Joint Venture
III. Bilanzierung von gemeinschaftlichen Tätigkeiten ( Joint Operations ) nach IFRS
1. Bilanzierung im Einzel- und Konzernabschluss der Partnerunternehmen
2. Bilanzielle Sonderfragen
2.1 Einbeziehung nach der Beteiligungsquote oder Abnahmequote?
2.2 Überproportionale Finanzierung durch einen Partner
2.3 Gewinnpoolung
2.4 Bilanzierung bei Auftragsfertigung
2.5 Drohende Verluste
IV. Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen ( Joint Venture ) nach IFRS
1. Bilanzierung im Einzelabschluss des Partnerunternehmens
2.Bilanzierung im Konzernabschluss des Partnerunternehmens
2.1 Einbeziehungspflicht in den Konzernabschluss
2.2 Vorbereitende Maßnahmen
2.2.1 Abweichender Bilanzstichtag oder abweichende Bewertungsmethoden
2.2.2 Währungsumrechnung
2.3 Erstmalige Bewertung
2.3.1 Ermittlung der Anschaffungskosten
2.3.2 Ermittlung der stillen Reserven und des Goodwill
2.4 Vorgehensweise bei der Folgebewertung
2.4.1 Außerplanmäßige Abschreibungen
2.4.2 Zwischenergebniseliminierung
2.4.3 Negativer Equity-Wert
2.5 Ausweis in der Bilanz
2.6 Anhangsangaben
V. Wesentliche Abweichungen der Bilanzierung nach HGB
VI. Fazit
5. Kapitel Kartellrecht
I. Vorbemerkung
II. Fusionskontrollrechtliche Bewertung von Joint Venture
1. Praktische Bedeutung für die Projektplanung
1.1 Entscheidungsmöglichkeiten der Kartellbehörde
1.2 Vollzugsverbot
1.3 Dauer des Prüfverfahrens
1.4 Verfahrensbedingte Publizität des Vorhabens
1.5 Verfahrenskosten
2. Der fusionskontrollrechtliche Begriff des Gemeinschaftsunternehmens
3.Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens
3.1 Frühester Zeitpunkt für eine Anmeldung
3.2 Förmliche Anforderungen
4.Verhältnis der deutschen zur europäischen Zusammenschlusskontrolle
4.1 Vorrang des Gemeinschaftsrechts
4.2 Verweisungsmöglichkeiten
4.2.1 Verweisung von den Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission
4.2.2 Verweisung von der Kommission an nationale Kartellbehörden
5.Beurteilung nach europäischem Recht
5.1Aufgreifschwellen
5.1.1 Gemeinschaftsweite Bedeutung
5.1.2 Umsatzschwellenwerte
5.1.3 Beteiligte Unternehmen
5.1.4 Umsatzberechnung
5.2Zusammenschlusstatbestand nach europäischem Recht
5.2.1 Gemeinsame Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen
5.2.2 Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen
5.3 Materielle Beurteilungsmaßstäbe
5.3.1 Konzentrative Effekte
5.3.2 Kooperative Effekte
5.4.Verhältnis zwischen Zusammenschlusskontrolle und Kartellverbot
5.4.1 Vorrang der Zusammenschlusskontrolle
5.4.2 Nebenabreden zum Zusammenschluss
Читать дальше