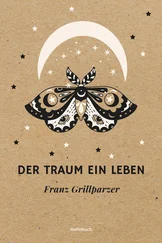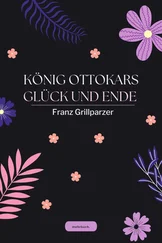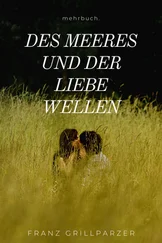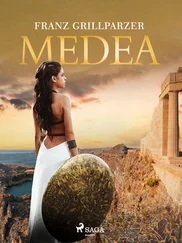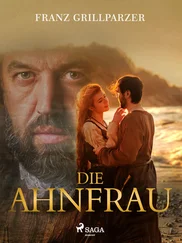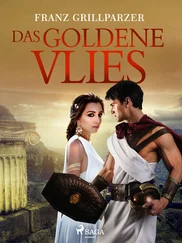Die Klage über das Verschwinden verbindlicher Lektürelisten in den Schulen (zumindest in Österreich)2 verdeckt die Tatsache, dass Kanons nur mehr als fluide, nicht selten identitätspolitisch missbrauchte Instrumentarien existieren. Sie sind keine Richtschnur mehr für (höhere) Bildung. Das kann man auch als die Gewinnung von Freiraum sehen, als Utopie eines neuen Bildungsideals, das im Austausch zwischen Lehrer:innen, Schüler:innen, Schulbehörden immer neue Listen entstehen lässt. Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus, anstelle frei verhandelter Lektüre-Listen, anstelle von Lust an literarischen Entdeckungen, an die Stelle einer notwendigen Erweiterung der nationalen, europäischen Kanons tritt nicht selten einfach die Einübung in Textsorten und kodifizierte Sprachpraxen als Vorbereitung für das Berufsleben.
Was bedeutet das alles für ein Literaturmuseum, das sich zwar der österreichischen Literatur vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart widmet, sich jedoch als europäisches Projekt versteht und von der Überzeugung getragen ist, dass Literatur immer auch Weltliteratur in einem mehrfachen Sinne ist? Die Kanon-Frage begleitete die Diskussionen der Kurator:innen von Beginn der Planungen an, wie könnte es auch anders sein. Die chronologisch-thematische Grundstruktur der Dauerausstellung folgt manchmal mehr, manchmal weniger kanonisierten Werken und Autor:innen. Sie legt dabei Schwerpunkte, die Platz auch für unbekanntere Positionen und Autor:innen lassen. Der Verfestigung kanonischer Tendenzen arbeitet die Fülle an Material, die Fülle an Bildern, Tönen, Mikrogeschichten und Objekten entgegen. Fast zu jedem Objekt lassen sich Geschichten erzählen, sei es eine zerrissene Arbeitshose Thomas Bernhards3 oder ein ethnologisches Fundstück aus dem 19. Jahrhundert (heimgebracht von der Weltreisenden und Reiseschriftstellerin Ida Pfeiffer). Die Regalstruktur des ehemaligen k.k. Hofkammerarchivs in der Wiener Johannesgasse bewirkt, dass sich eine festgefügte (Kanon-)struktur der Gestaltung geradezu aufdrängt, diese jedoch in der Abfolge und großen Zahl an Regalfächern gleich wieder zum Verschwinden bringt.
Es geht nicht nur um Grillparzer und sein Schattendasein als Klassiker, es geht um das Verschwinden von Lektürekompetenzen überhaupt und die oft konstatierte, kommentierte, beklagte Tatsache, dass von einem Lektürefundament weder bei den Abgänger:innen von höheren Schulen noch bei Germanistikstudent:innen ausgegangen werden kann. Wie die Mehrzahl der Museumsbesucher:innen verfügen auch sie über Vorkenntnisse, die sich Zufällen, Bildungsreminiszenzen, persönlichen Interessen, Peer Groups und sehr unterschiedlich intensiv betriebenen Studien verdanken können. Größte Belesenheit und große Ahnungslosigkeit liegen nahe beieinander. Damit geht eine Erfahrung von Lehrer:innen und Museumspädagog:innen einher, die frühere Vermittler:innen in dieser Form nicht machen konnten: dass nämlich die Artefakte alle gleich sind; dass, in unserem Falle, Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ ein ebenso ferner Planet ist wie Handkes „Langsame Heimkehr“, oder wie es Grillparzers Dramen und Lustspiele sind. Deshalb kann sich die Lust am Text im besten Fall an jedem beliebigen Objekt im Museum entzünden, kann sich das Interesse an der Materialität von Literatur, an Handschriften und Stimmen, frei von bestimmten Erwartungen an jedem Punkt der Ausstellung festsetzen. Allerdings: Das freie Schweifen, das unvoreingenommene Entdecken folgt den Spuren, die andere, die die Kurator:innen und Gestalter:innen gelegt haben. Was heißt das nun für Grillparzer?
Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich kein Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek an dieser Stelle, ist doch das denkmalgeschützte Arbeitszimmer des habsburgischen Beamten Teil der Ausstellung. 1811 versuchte Grillparzer erstmals, eine Stelle in der k.k. Hofbibliothek zu erlangen; der Wunschtraum, Bibliothekar zu werden, scheiterte aber. 1815 trat er bei der Hofkammer, dem späteren Finanzministerium, in den Staatsdienst und erhielt 1832 die Stelle eines Hofkammerarchivdirektors. Im Revolutionsjahr 1848 erfolgte der Umzug in ein neues Archivgebäude, das heutige „Grillparzerhaus“. (Dessen Anmutung, von außen betrachtet, eher ein biedermeierliches Palais vermuten ließe, als einen Zweckbau für die Aufbewahrung von Akten). Mit seiner ebenfalls denkmalgeschützten Regalstruktur zählt es zu den ältesten europäischen Verwaltungsarchiven. Dieser Ort drückt an sich schon das zwiespältige Verhältnis des für eine aufgeklärte monarchische Ordnung eintretenden Dichters zur Realverfassung des Habsburgerstaates aus.
Im Zentrum des Grillparzer gewidmeten Bereichs steht das Arbeitszimmer, dessen auffälligstes Möbelstück ein Stehpult ist, an dem Grillparzer mit ziemlicher Sicherheit auch an seinen literarischen Texten gearbeitet hat. Auch ohne inszenatorische Eingriffe (lediglich die Schriftstücke auf dem Schreibtisch und die Bücher auf dem Bücherbord im Hintergrund sind Zutaten der Kurator:innen) wirkt das Zimmer als habsburgisches „Büro“; karg und ohne jegliches Zeichen von Extravaganz symbolisiert es die Zweckmäßigkeit der Verwaltung. Das Kruzifix, angebracht über dem Stehpult, gemahnt an die Staat und Verwaltung überwölbende göttliche Ordnung. In der Gangflucht außerhalb des Zimmers inszeniert die Ausstellung Grillparzers Doppelleben als Beamter und Schriftsteller. Wie an vielen Stellen wird auch hier das historische Setting durchbrochen – durch das Thema gestalterisch wie inhaltlich umspielende, erläuternde, ironisierende Elemente.
Grillparzers Selbstzweifel als Schriftsteller, seine Befürchtung gar, sowohl „zur dramatischen Poesie“ als auch zum „Lustspiel“ „wenig Anlage“ zu besitzen, wurde vom Comiczeichner und Illustrator Nicolas Mahler zum Ausgangspunkt für ein Grillparzer-Comic genommen; es ist auf einem Touchscreen, der sich unmittelbar vor dem Zimmer befindet, zu lesen und zu betrachten. Grillparzer sitzt auf einem Hocker vor seinem Schreibpult, wie es der tatsächliche Grillparzer ein paar Meter weiter tatsächlich tat, und schreibt mit vertrocknender „Dinte“ Sätze, die alle wie erfunden klingen, aber allesamt den Tagebüchern des Autors entnommen sind. „Wieder was zu schreiben! Ja! Aber was?“, so lautet die Eingangsfrage des ersten Bildes. Das letzte zeigt das Schreibpult ohne den Schriftsteller, am Boden liegen Blätter herum. Wollte doch Grillparzer „eine Tragödie in GEDANKEN schreiben können“. „Es würde ein Meisterwerk werden!“ und ohne den Körper des Dichters auskommen, der in den strichlierten Umrissen der Zeichnung verschwindet.
Daneben befindet sich eine Hörstation, die kommentierende Nacherzählungen von Grillparzer-Texten durch Autor:innen und Literaturwissenschaftler:innen bietet.4 Der Autor Clemens Setz erzählt die Geschichte des armen Spielmanns auf so anrührende Weise, dass einem das Schicksal der Figur zu Herzen gehen muss. Die Autorin Anna Kim widmet sich dem Schicksalsdrama „Die Ahnfrau“, ein Genre, das wohl nur mehr über den Umweg aktueller Populärkultur, Kim vergleicht es mit den Hollywood-Blockbustern unserer Tage, vermittelbar ist. Die Hörstationen wollen auch Anregungen sein, wie mit alten Texten umgegangen werden könnte, indem sie zum Beispiel ganz einfach nacherzählend kommentiert werden. Wobei sich zeigt, dass das Nacherzählen eine gar nicht einfache und höchst subjektive Kunst ist und dabei Erkenntnisse lebendiger vermitteln kann, als dies ein akademischer Aufsatz in der Regel tut. Konstanze Fliedl weist in ihrem Beitrag zu „Weh dem, der lügt!“ darauf hin, dass Wahrheit und Lüge immer kontextabhängig sind, die Wahrheit manchmal nicht ernst genommen wird, weil sie als Scherz aufgefasst wird, was die Hauptfigur, der den anderen sprachlich überlegene Leon ausnützt. Wahre Sachverhalte lassen sich in der verbalen Kommunikation so zurechtbiegen, dass sie zwischen Wahrheit und Lüge changieren, was Leon meisterhaft beherrscht. Er lügt, auch wenn er tatsächlich die Wahrheit sagt, stellt Konstanze Fliedl fest. Der moralfeste Wahrheitsfanatiker Bischof Gregor muss schließlich konzedieren, dass der Anspruch die besten Absichten zerstören kann. Aus diesem Diskurs ließe sich jedenfalls ein Gespräch über Wahrheit und Lüge entwickeln, das im Zeitalter von Social Media notwendiger ist denn je.
Читать дальше