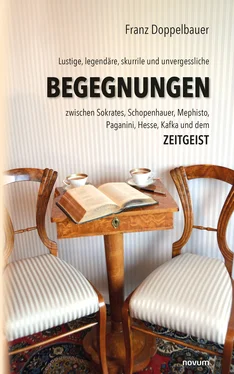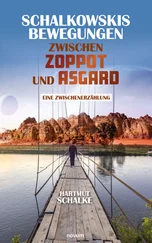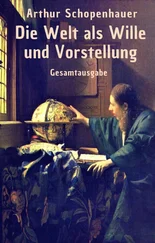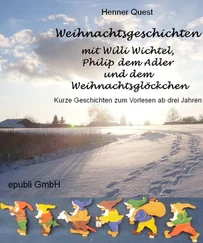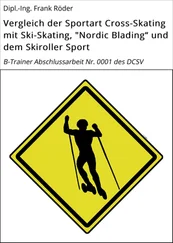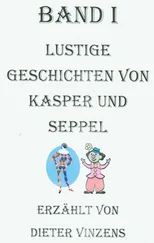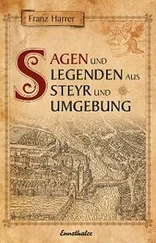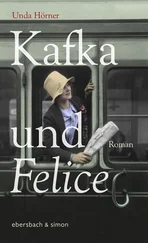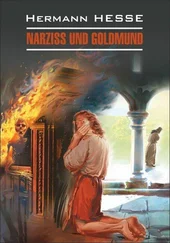Amerika, quo vadis?
Man braucht aber nicht so weit in die Ferne schweifen, denn die Verdrehung der Wörter ist so nah.
Wer in den vergangenen Wochen und Monaten die Sitzungen des Österreichischen Parlamentes aufmerksam verfolgt hat, der kann nur fassungslos zusehen, wieviel Wortverdrehung, Sprachverrohung und hinterhältige, absichtlich gehässig herbeigeführte Sprachzerstörung geschieht – nicht aus Missverständnis, sondern in voller Absicht. Das alles im Namen von „lebendiger parteipolitischer Diskussion“, von „parlamentarischem Diskurs“. Hohn, Spott und Niedertracht kennzeichnen manche dieser Sitzungen in unserem sogenannten „Hohen Haus“. Vor lauter Schande über diese unsere gewählten Volksvertreter wäre es ethisch unvertretbar, Jugendlichen in dem Fach „Politische Bildung“ oder im Fach Deutsch unter dem Fachgebiet „Rhetorik“ Passagen von diesen Sitzungen zu zeigen, in denen – die Videoaufzeichnungen und Sitzungsprotokolle beweisen es – Kraftausdrücke wie „Sauerei“, „Sie sind wohl komplett verblödet“, „scheißegal“, „verarscht“, „betäubtes Faultier“, „Heuchelei“, „Lüge“, „jüngster Demenzpatient Österreichs“ (gemeint ist der Finanzminister), „Was das für Beidl sind“ usw. verwendet werden. Oder noch schlimmer: Ein Foto mit nachweislich gefälschtem Datum wird absichtlich von einer Parlamentarierin der FPÖ am Rednerpult dem Plenum gezeigt, um dem politischen Mitbewerber – in diesem Fall aber Hassobjekt – zu schaden. Nach sofortiger Aufdeckung dieser Lüge folgt weder eine Entschuldigung noch Einsicht und – was nur in Österreich durchgeht – kein Rücktritt. Geht’s noch? Die offen zur Schau gestellte Lüge und bösartige Unterstellung wird dem sachlichen, fairen, offenen, harten Dialog vorgezogen – des politischen Kleingeldes vor Wahlen wegen.
Tausende bemühte Lehrer unterrichten unzählige Schüler, welche Grundregeln des Zusammenlebens und des richtigen Dialoges und auch Grundwerte wie Anstand, würdevollen Umgang mit Andersdenkenden und Respekt in einem zivilisierten Land wie Österreich gelehrt und vorgelebt bekommen sollen. Dafür legen diese Lehrer den Amtseid ab; bei Zuwiderhandeln kommt es zu einem Disziplinarverfahren durch die Republik Österreich.
Ein Schüler irgendeiner österreichischen Schule würde mindestens ein „Wenig zufriedenstellend“ – wenn nicht sogar einen Schulverweis – bekommen, wenn er so mit Lehrern und Pädagogen spräche.
Quo vadis, Austria?
Gemessen daran scheint es ja geradezu harmlos zu sein, welche verbalen Ausdrucksweisen Jugendliche und auch zum Teil Erwachsene mit ihrer Zeitgenossenschaftsprosa in Mails und SMS pflegen.
Im Reich der „eingenetzten Wortfetzen“, wie das Daniel Glattauer zu nennen pflegt, üben E-Mailer an ihren Deutschlehrern Rache für die schikanösen, stilistisch perfekt zu schreibenden Aufsätze, hochsprachlichen Erörterungen und die Pflicht, schöne, ganze Sätze schreiben zu müssen. Die Revolte des Schreibens, zu formulieren, wie eben der Schnabel gewachsen ist, des emailisierten Wortfetzenkonstruierens ohne Prädikate, Adjektive und Konjunktionen mit anschließendem Emoji, dem Gefühlsausdruck mit Tränen, Herzerl oder dem Mittelfinger – oder wenn’s gut geht – einem grr, äh, gähn oder einem Smiley, diese Revolte des Verfassens dieses Silbenirrwitzes durch unsere jungen Alltagssprechkosmopoliten ist niemals – wie in den vorigen Beispielen geschildert – gegen jemanden gerichtet, höchstens gegen die bemühten, pflichtbewussten, sprachästhetischen und „eh ganz ok-en“ Deutschlehrer; sie sind ein Ausdruck ihres sozialen Umfeldes und altersadäquaten Formulierens. Das alles ist nicht gemeingefährlich; Anlass zur Sorge höchstens, wenn es – wie man doch zu hoffen wagt – darum geht, einmal einen gefühlvollen und emotionalen Liebesbrief oder eine Einladung zu einem Rendezvous zu schreiben. Was mehr zu denken gibt, ist die Tatsache, dass wir heute unter einem permanenten Erreichbarkeitsstress leiden, wobei die Begründungspflicht bei dem liegt, der einmal nicht abhebt. Diese von uns gar nicht mehr wegzudenkende Dauerpräsenz mit dem Smartphone hat uns unwillkürlich und unverhofft in ein Abhängigkeitsverhältnis manövriert, in dem vor langer, langer Zeit nur die Tag und Nacht unentwegt erreichbaren Dienstboten standen. Wir sind die modernen – längst obsolet geglaubten – Dienstboten des 21. Jahrhunderts geworden; permanent erreichbar für Dienstgeber, Partner, Kinder und Schüler im Homeschooling. Wem das zu viel wird, der läuft Gefahr, sich im Burnout wiederzufinden. Das ist für immer mehr Menschen der persönliche Preis für die neue Technokratie. Wenn René Descartes behauptet, dass nur der ein Mensch ist, der denke, so ist man heute nur wer, wenn man auf dem letzten Stand der Technik ist.
Twittero ergo sum.
Kapitel 3
Niki Lauda trifft Günther Anders
Technik – Segen oder Fluch
„Wenn Ihr mich sucht,
sucht mich in Euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
werde ich immer bei euch sein.“
Diese Worte, welche angeblich von Rainer Maria Rilke stammen sollen, stechen einem ins Auge, wenn man das Kondolenzbuch aufschlägt, nachdem es am 26. Mai 1991 zu einem folgenschweren Flugzeugabsturz der Boeing 767 „Mozart“ über Thailand gekommen war. Ein technisches Gebrechen war die Ursache – die Schubumkehr setzte zehn Minuten nach dem Start in Bangkok plötzlich unerwartet ein. Die erfahrenen Piloten Thomas John Welch (CA) und Josef Thurner (FO) hatten keine Chance, den furchtbaren Unfall zu verhindern. „Verdammt!“, war laut Voice Recorder das letzte Wort des Flugkapitäns.
Verdammt viele Menschen kamen dabei ums Leben – ein Ereignis, das der Eigentümer der damaligen Fluglinie Niki Lauda später mit „Mein Rennunfall war nichts gegen das, was ich dort gesehen habe. (…) Die Ursache für den Absturz war ein Konstruktionsfehler.“ kommentierte.
Etwa neun Jahre später, am 11. November 2000, starben in Kaprun bei einer Brandkatastrophe in der Gletscherbahn 155 Menschen. Die Ursache für das Inferno waren der überhitzte Heizlüfter und auslaufendes Hydrauliköl.
Aufgrund dieser beiden Ereignisse – und man könnte noch unzählige weitere aufzählen, seit es technische Erfindungen und Errungenschaften gibt, welche allen sehr nahe gehen – drängen sich bohrende Fragen nach dem Sinn, den Gefahren, dem stetigen Fortschritt der Menschheit und der Angst vor technischen Katastrophen auf.
Zwei der hervorragendsten Persönlichkeiten, welche unterschiedlicher nicht denken könnten, sollen im Folgenden die beiden Positionen auf den Punkt bringen und dem Leser zeigen, was wir aus der Vergangenheit lernen könnten bzw. auf welche Zukunft wir zusteuern.
Die beiden Proponenten sollen vollkommen frei und unzensuriert, also wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, diskutieren und streiten dürfen; wir, die wir dem surrealen, aber nicht weltfremden Disput folgen werden, sind Zeugen eines einmaligen und epochalen Ereignisses, das vielleicht – aber eben nur vielleicht – die Welt verändern kann.
Der eine ist Niki Lauda, den vorzustellen sich erübrigt, weil ihn alle als Formel-1-Legende, später als Airliner und schließlich als Berater eines Formel-1-Teams kennen. Bei allen Tätigkeiten, die er mit Leidenschaft und Herzblut, mit Emotion und nahezu perfekter Sachkenntnis und Akribie erledigt, preist er stets den Fortschritt in der und durch die Technik als Segen für die Menschheit.
Der andere heißt Anders, Günther Anders. In seiner Vita heißt es, dass er ursprünglich den Namen Günther Stern hat. Als sein Vorgesetzter sagt, es schicke sich nicht, in Zeiten wie diesen – dem Nationalsozialismus – den jüdischen Namen Stern zu tragen, meint er: „Dann nennen Sie mich doch irgendwie anders!“. Ein neuer Stern ist geboren. Er lebt von 1902 bis 1992, ist Philosoph, Kritiker und Publizist, sein Vater William Stern war Psychologe und gilt als Erfinder des Intelligenzquotienten. Anders wird in Breslau geboren, wächst in einer bürgerlichen, gebildeten jüdischen Familie auf, studiert Kunstgeschichte und Philosophie bei Husserl und Heidegger in Freiburg und Marburg, wo er seine erste Frau Hannah Arendt kennen und lieben lernt. Er emigriert 1933 nach Paris. Nach der Trennung von seiner Frau flieht er in die USA, wo er Kontakte zu Adorno, Marcuse, Thomas Mann und Bertolt Brecht pflegt. Die Konstruktion und der Abwurf der Atombombe beschäftigten ihn dermaßen, dass er sein philosophisches Hauptwerk „Die Antiquiertheit des Menschen“ schreibt, in dem er über die durch die Atombombe möglich gewordene Ausrottung der gesamten Menschheit und die damit einhergehende, vom Menschen selbst inszenierte Apokalypse schreibt. Später verfasst er unter anderem Bücher wie „Mensch ohne Welt“, „Lieben gestern“ und „Hiroshima ist überall“. Er stirbt 1992 in Wien. Nun aber genug der Vorstellung, er möge doch seine bewegenden Erkenntnisse selber vortragen und in der „Defensio“, dem Streitgespräch, mit Niki Lauda verteidigen.
Читать дальше