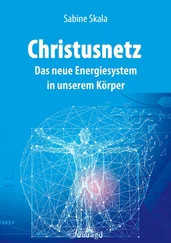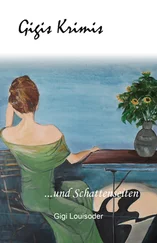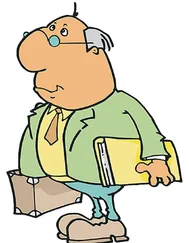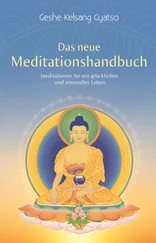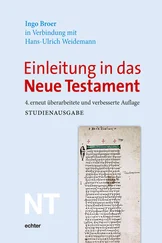Aufbau und stilistische Besonderheiten
Das Johannesevangelium teilt sich in zwei große Teile auf, die oft das „Buch der Zeichen“ (Kap. 1–12) und das „Buch der Herrlichkeit“ (Kap. 13–21) genannt werden. (Zu den Details der Unterabschnitte unter dem jeweiligen Hauptabschnitt s. die Überschriften im Kommentarteil).
Das Johannesevangelium erzählt die Geschichte Jesu zunächst in ihrer galiläischen und judäischen Umgebung in den Jahrzehnten vor dem Ersten Jüdischen Krieg gegen Rom. Zugleich erzählt es eine kosmologische Geschichte vom präexistenten Wort Gottes, das in die Welt kommt, Satan besiegt und zum Vater zurückkehrt. Auf der geschichtlichen Ebene der Erzählung beschreibt das Evangelium die Interaktion Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und seinen Gegnern. Diese Ebene tritt vornehmlich zutage in der Handlung vom Augenblick der Identifikation Jesu durch Johannes den Täufer ( Joh 1,19–36) bis zu seiner Kreuzigung (Kap. 19) und den Erscheinungen des Auferstandenen vor den Jüngern (Kap. 20–21). Die kosmologische Ebene der Erzählung erscheint in den Kommentaren und Reflexionen über das Leben und den Tod Jesu, und zwar sowohl aus der Perspektive des Erzählers als auch aus der von Jesus selbst.
Wie die synoptischen Evangelien und andere Literatur dieser Zeit auch bedient sich das Johannesevangelium einer Reihe stilistischer Mittel, um die Aufmerksamkeit auf seine Hauptthemen zu lenken und die historische mit der kosmologischen Erzählebene zu verknüpfen. Dazu zählen Wiederholungen (z.B. „es kommt die Zeit“; „es kommt die Stunde und ist schon jetzt“ [ Joh 4,21. 23; 5, 25.28; 16,2.25.32], Doppeldeutigkeiten (z.B. „erhöht werden“ in Joh 3,14–15mit der doppelten Bedeutung von Kreuzigung und Erhöhung), Missverständnisse (vgl. Nikodemus‘ Frage, wie es möglich sei, „wiedergeboren“ zu werden, Joh 3,3–5) und Ironie (so denkt die Menge nach Joh 7,34–35, dass Jesus in die Diaspora „hingehen“ werde, während die Leserinnen und Leser wissen, dass er von seinem Tod und der Rückkehr zum Vater spricht).
Die Komposition des Johannesevangeliums orientiert sich an einigen „Zeichenerzählungen“, die oft von langen Redeteilen begleitet werden (z.B. Joh 6, wo die lange „Brotrede“ auf die Vermehrung von Brot und Fischen und den Seewandel Jesu folgt). Die Erzählungen über „Zeichen“ berichten von Wundertaten Jesu und haben tendenziell folgende Grundstruktur: Auf die Identifikation eines Problems folgt zunächst die Erwartung, dass Jesus die Lösung liefern wird, die jedoch augenscheinlich enttäuscht wird, dann das Zeichen selbst und sein Nachspiel. Bei der Hochzeit zu Kana in Joh 2,1–12z.B. weist Jesu Mutter ihn darauf hin, dass der Wein ausgegangen ist, und erwartet von ihm, dass er etwas dagegen unternimmt. Er tadelt sie ( Joh 2,4) und stellt fest, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Schließlich vollbringt er das Wunder. Der Verwalter wundert sich, und der Erzähler erklärt: „Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.“ ( Joh 2,11) Dieses Muster legt nahe, dass die Wunder Jesu nicht seine übermenschlichen Fähigkeiten demonstrieren, sondern seine Identität als Sohn Gottes bezeugen sollten. Dieser Aspekt der johanneischen Zeichen erinnert an Ex 10,2, wo Gott Mose mitteilt, dass die Zeichen, die er unter den Ägyptern vollbracht hat, das Volk zu der Erkenntnis führen sollten: „Ich bin der Herr.“ Wie erwähnt, bildeten diese Zeichenerzählungen nach Ansicht einiger Fachleute usprünglich eine eigene Quelle, derer sich der Autor des Johannesevangeliums bediente.
Ein anderes Beispiel für den Einsatz bestimmter literarischer Stilmittel zeigt sich in den Berufungserzählungen der Jünger. Fast immer handelt es sich bei der Person, durch die neue Anhänger zu Jesus kommen, um jemanden, der vorher selbst sein Anhänger geworden war. Johannes der Täufer etwa befiehlt zweien seiner Jünger, Jesus nachzufolgen. Einer von ihnen, Andreas, erzählt das seinem Bruder Simon Petrus, der daraufhin ein Jünger Jesu wird ( Joh 1,42). Jesus findet Philippus, der es wiederum Nathanael erzählt, der daraufhin Jesus begegnet und zum Jünger wird ( Joh 1,49). Die Samaritanerin trifft Jesus und legt darüber in ihrer samaritanischen Gemeinschaft Zeugnis ab. Daraufhin laden ihre Mitglieder Jesus ein, bei ihnen zu bleiben, woraufhin sie zu Gläubigen werden ( Joh 4,41–42). Am Ende des Evangeliums wird deutlich, welchem Zweck dieses Muster dient, als nämlich Thomas sich weigert, dem Zeugnis der Jünger zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, solange er es nicht selbst sehen kann. Jesus kehrt zurück und fordert ihn auf, ihn anzusehen und zu berühren, doch tadelt er ihn auch: „Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ (Joh 20,29). Hier wendet sich der johanneische Jesus eindeutig an die Leserinnen und Leser, die Jesus nicht direkt sehen werden, aber dennoch glauben. Die abschließende Erklärung (Joh 20,30–31) weist darauf hin, dass für künftige Generationen das Johannesevangelium das Hilfsmittel sein wird, mit dem Glaubende Jesus begegnen.
Adele Reinhartz
Johannes 1
1Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.[*] 2Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.[*] 4In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat‘s nicht ergriffen.
6Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. 7Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf dass alle durch ihn glaubten. 8Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht.
9Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen[*]. 10Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es nicht. 11Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen glauben, 13die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
14Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
15Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.
16Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 17Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 18Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt.
Joh 1,1–18Prolog Im Gegensatz zu Matthäus und Lukas fehlt bei Johannes eine Erzählung von Jesu Empfängnis und Geburt; weder Maria noch Josef spielen im Bericht von seinen menschlichen Ursprüngen eine Rolle. Vielmehr wird Jesu Ankunft in der Welt mit kosmologischer Terminologie beschrieben und seine Rolle als Sohn Gottes hervorgehoben. Die poetische Struktur des Prologs und das Fehlen einiger der hier verwendeten Begriffe im Rest des Evangeliums lassen vermuten, dass Joh 1,1–18auf einem früheren Hymnus aufbauen könnte. 1,1–3Im Anfang, lässt Gen 1,1 anklingen. Das Wort, die Schöpfungskraft und Erlösungsmacht Gottes (Ps 33,6), die mit Jesus identifiziert wird ( Joh 1,9. 14. 17). Es deutet auf die personifizierte Weisheit hin (Spr 8,7–30; Weish 9,2.9; 18,15; Sir 24,1–9; 43,26). Für den jüdischen Philosophen aus Alexandria, Philo, war der Logos Gottes das erste Ergebnis der Schöpfung (leg.all. 3,175). Die Weisheit des Ben Sira (Jesus Sirach) identifiziert die Weisheit mit dem göttlichen Gebot, d.h. mit der Tora (Sir 24,22–23). Diese Bestimmung besteht auch im rabbinischen Zeitalter fort (vgl. BerR 1,10 [nicht eher als im fünften Jahrhundert anzusetzen], wo beschrieben wird, wie Gott die Tora als Bauplan zurate zieht, bevor er die Welt erschafft). Vgl. auch die Verwendung von memra (übers. „Wort“) in den aram. Targumim zur Genesis (vgl. „‚Logos’ als ein jüdisches Wort: Der Johannesprolog als Midrasch“). Bei Gott, wie in Spr 8,22–31: „War ich [die Weisheit] da […] da war ich beständig bei ihm [, dem Herrn]“. 1,4Leben, dessen Quelle Gott ist (Gen 1,20–25). Licht, das erste Werk der Schöpfung (Gen 1,3); ein häufiges Bild für Gott oder Gottes Anwesenheit und Wohlwollen (Ps 27,1; 36,10; Jes 2,5; vgl. auch Weish 7,26). Der Menschen, vielleicht ein Vorgriff auf die Vorstellung, die in Joh 10,16; 11,52; 12,32 ausgeführt wird, dass Jesus gekommen sei, um „die Welt“ zu retten und nicht nur eine bestimmte ethnische Gruppe. 1,5Das Licht scheint, erinnert an Gen 1,3. Der Kontrast zwischen Licht und Finsternis, der im JohEv stark ausgeprägt ist, taucht auch in den Schriften vom Toten Meer auf, z.B. in 1QS 3,13–4,26, aber ein direkter Einfluss dieser Schriftrollen auf das Evangelium ist unwahrscheinlich. 1,6–8Eine Vorschau auf Joh 1,19–34. Johannes, der Täufer, wird von Josephus erwähnt (Ant. 18,116–119). 1,10–12Diese Verse fassen die historischen und kosmologischen Perspektiven des Evangeliums zusammen: Das eigene Volk Jesu, die Juden, nahm ihn nicht an, sondern plante ihn zu ermorden; diejenigen, die Jesus angenommen haben, werden Gottes Kinder und erhalten das ewige Leben. Welt, gr. kosmos, bezeichnet sowohl die Schöpfung als auch die Menschheit, aber auch häufig diejenigen, die Jesus ablehnen (Joh 12,31; 16,11). 1,11Die Seinen, die Juden ( Joh 4,22; vgl. auch Ex 19,5). 1,12–13Der Unterschied zwischen einem vererbten Bund, wie dem der Juden, und einem auf Glauben gründenden Bund (vgl. Joh 8,33–40). An seinen Namen glauben, gaben ihm gebührend die Ehre. Dieser Ausdruck taucht auch in äthHen 67,8–10 in Bezug auf Gott auf. Gab er Macht […] zu werden, bezieht sich vielleicht auf das „Recht“ oder die „Befugnis“, aber es handelt sich wohl eher um eine andere Art, das „Werden“ als Folge des göttlichen Handels auszudrücken. Gottes Kinder, im Gegensatz zu den „Kindern nach dem Fleisch“, d.h. den Nachkommen Abrahams (Joh 8,33–40). 1,13Geblüt, die biologische Herkunft. 1,14Das Wort ward Fleisch, eine paradoxe Formulierung, da das Fleisch vergänglich ist, der Logos aber eine ewig-göttliche Qualität besitzt; vgl. Jes 40,6–8: „Alles Fleisch ist Gras [das] verdorrt […] aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich“. Dieser Aspekt kennzeichnet die „Menschwerdung“, das Wort, das Fleisch wird. Die Vorstellung, dass ein göttliches Wesen gleichzeitig menschlich sein kann, wird oft als wesentliche Trennungslinie zwischen dem Judentum und dem Christentum gesehen. Im Judentum der biblischen Zeit und des zweiten Tempels allerdings glaubte man an übernatürliche Wesen, z.B. an Engel, die menschliche Form annehmen können (z.B. der Engel in Ri 13; Rafaël im Buch Tobit). Die Grenzen zwischen Menschlichem und Göttlichem wurden folglich als durchlässiger und weniger absolut wahrgenommen. Herrlichkeit, gr. doxa, eigentlich das Äquivalent der LXX für das hebr. kavod, die sichtbare Manifestation der Gegenwart Gottes (z.B. Ex 16,10). Eingeboren, einzigartig in seiner Sohnesbeziehung zum Vater. Im Hintergrund könnten aristotelische Vorstellungen der Fortpflanzung stehen, nach denen dem Sohn im Idealfall das Abbild seines Vaters eingeprägt wird (vgl. Arist.gen.an. 722 und passim). Wohnte unter uns, das Griechische bedeutet wörtlich „in einem Zelt wohnen“, eine Anspielung auf die Stiftshütte in der Wüste, dem Vorläufer des Jerusalemer Tempels (z.B. Ex 25,9). Es könnte auch eine Verbindung zur hebr. schechina bestehen, die in manchen Texten (z.B. in TOnq zu Dtn 12,5) als Terminus technicus für die Präsenz Gottes in seinem Volk verwendet wird, also als Äquivalent zum Begriff kavod im Tanach. 1,15Johannes zeugte […], verweist nach vorne auf Joh 1,19, auf das Zeugnis des Täufers vor den Jerusalemer Priestern und Leviten. 1,16Fülle, gr. plērōma (Kol 1,19), taucht bei Johannes nur hier auf. Die genaue Bedeutung ist unklar; es könnte sich schlichtweg auf den Überfluss an geistlicher Nahrung (symbolisiert durch das Wasser [ Joh 4,14–15] und das Brot [Joh 6,1–14], das die Gläubigen erhalten) beziehen. 1,17–18Gegenüberstellung von Jesus und Mose sowie die Überlegenheit des Evangeliums gegenüber dem Gesetz (Tora; Ex 24,12). 1,17Gnade und Wahrheit, Gottes liebende Gegenwart (hebr. chesed, übers. „unerschütterliche Liebe“, z.B. Ps 85,10) und Treue (hebr. ’emet, übers. „Wahrheit“, die nicht nachlässt). 1,18Niemand hat Gott je gesehen, der Kontrast zwischen Jesus und Mose wird weiter ausgeweitet: Der Vers hebt hervor, dass Jesus derjenige ist, der Gott der Welt bekannt macht – und nicht als Mose, dem es nicht gestattet war, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen (Ex 33,18).
Читать дальше
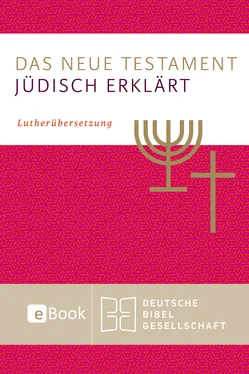


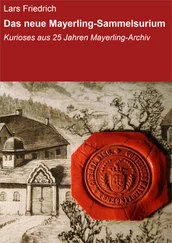
![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)