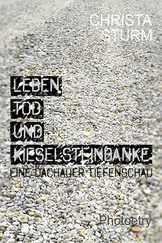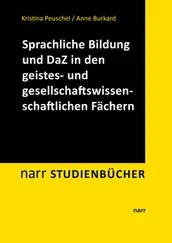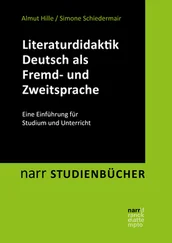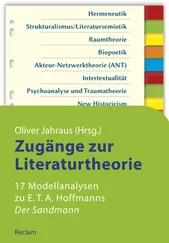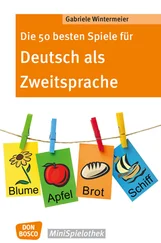1.2 Performativität und Performanz in der SprachwissenschaftSprachwissenschaft
Wir steigen ein mit der Performanz , denn die sprachwissenschaftliche Verwendung von performativ lässt sich besser nachvollziehen, wenn man die von Performanz bereits kennt. In der Sprachwissenschaft kommt der Ausdruck als Fachbegriff in der Regel nicht alleine vor, sondern wird in Opposition zu Kompete nz Kompetenz gebraucht. Das zweigliedrige (= dichotome) Begriffspaar Sprachkompetenz/SprachperformanzSprachkompetenz/Sprachperformanz (im Englischen linguistic competence vs. linguistic performance ) stammt von dem Linguisten Noam Chomsky (*1928), der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Paradigmenwechsel hin zu einer damals ‚neuen‘, vorrangig kognitiv orientierten Linguistik einläutete (vgl. Zepter 2013: 80f.).
Dabei greift Chomsky mit Sprachkompetenz/Sprachperformanz eine Unterscheidung auf bzw. führt sie weiter, die vor ihm bereits Ferdinand de Saussure (1857-1913), ebenfalls ein maßgeblicher Wegbereiter in der Sprachwissenschaft, mit seiner dichotomen Unterscheidung von lang ue langue (SprachsystemSprachsystem) und paro le parole (SprachgebrauchSprachgebrauch) getroffen hatte. Sprachliche Performanz (ebenso parole ) bezieht sich in diesem Kontext auf den konkreten Gebrauch von Sprache , also auf jedes in einer bestimmten Situation, zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort stattfindende individuelle Sprachverwendungsereignis .
 Abb. 1.4:
Abb. 1.4:
Performanz
Immer dann, wenn wir Sprache gebrauchen, wenn wir sprechen oder wenn wir zuhören, sind das Instanzen unserer Sprachperformanz. Chomsky ging u.a. von der Beobachtung aus, dass wir beim Gebrauch unserer Erstsprache, die wir in unseren ersten Lebensjahren in der Regel scheinbar mühelos und ohne expliziten Sprachunterricht unserer Eltern erwerben, beliebig Sätze bilden können – Sätze, die wir ggf. vorher noch nie irgendwo gehört haben. Man kann das selbst ausprobieren. Denken Sie sich aus, was Sie in zehn Jahren gerne machen möchten, und erzählen Sie das einer Freundin/einem Freund oder schreiben Sie es auf. Von Relevanz ist nicht so sehr, was Sie inhaltlich sagen; Chomskys Punkt wäre stattdessen, dass Sie sich bei Ihrer Zukunftsgeschichte nicht darauf beschränken werden, einzelne Wörter unverbunden aneinanderzureihen. Sie werden Sätze bilden, die einer bestimmten Ordnung, einer Satzstruktur, folgen; und zwar auch, wenn Sie gar nicht explizit darauf achten oder wenn ein Satz dabei ist, den Sie inhaltlich so vorher noch nicht in einem anderen Kontext gehört haben. Selbst wenn Sie im Rahmen Ihres Sprachgebrauchs Fehler machen, wissen Sie im Prinzip doch, wie Sie auf einer basalen Ebene in Ihrer Erstsprache grammatisch korrekte Sätze bilden können. Tiere, so Chomsky, können das nicht, nur Menschen sind hierzu in der Lage.
Chomskys zentrale These war, dass eine solche SprachverwendungSprachverwendung (= Sprachperformanz) nur auf der Basis unbewusster kognitiver Strukturen bzw. nur auf der Grundlage einer kognitiven Sprachkompetenz möglich ist (vgl. u.a. Chomsky 2002: 48). Im Visier hatte er eine Kompetenz, über die Menschen, aber nicht Tiere, allgemein von Geburt an verfügen und die sie befähigt, Sprache zu erwerben. Seit den 1950er Jahren konzentriert sich seine Forschung auf die Erschließung der Sprachkompetenz mit dem Ziel, eine Theorie über das damit verbundene syntaktische (= satzstrukturbezogene) Basiswissen zu entwickeln.
Die Erforschung von Sprachperformanz ist diesem Ziel untergeordnet bzw. tritt dahinter zurück. Aber man muss Chomskys Fokus nicht folgen und kann den linguistischen Performanz-Begriff im Prinzip unabhängig von dem Begriffspaar Kompetenz/Performanz und einer spezifischen Priorisierung der beiden Ebenen nutzen. Wertfrei bezieht er sich auch dann auf den Gebrauch von Sprache, also auf die konkrete Sprachverwendung.
Zum Ausgangs- und Ankerpunkt theoretischer Überlegungen avanciert diese konkrete Sprachverwendung bereits in den 1960er Jahren bei dem Sprachphilosophen John L. Austin (1911-1960), der für die Linguistik auch den Begriff der Performativität geprägt hat. Anders als Chomsky interessierte Austin sich im Besonderen für die Bedeutungsdimension von sprachlichen Äußerungen, d. h. für die Frage, was Sätze, wenn wir sie im Kontext einer konkreten Sprachverwendung äußern, bedeuten und wie sich diese Bedeutung systematisch beschreiben lässt.
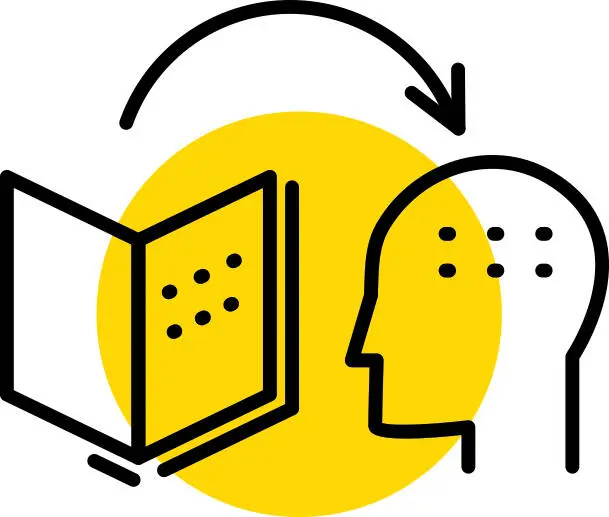 Sprachphilosoph ieSprachphilosophie vs. Linguist ikLinguistik
Sprachphilosoph ieSprachphilosophie vs. Linguist ikLinguistik
Seit dem 19. Jahrhundert und den Arbeiten von Ferdinand de Saussure (1857–1813) wird die Sprachwissenschaft auch als Linguistik bezeichnet. Die Sprachwissenschaft ist eine wissenschaftliche Disziplin, die darauf abzielt, Sprache und Sprechen systematisch zu beschreiben und zu erklären. Die moderne Sprachwissenschaft (= Linguistik) geht grundlegend vom Zeichencharakter menschlicher Sprache aus (→ Ein Wort, z. B. Baum , ist ein sprachliches Zeichen, das als Stellvertreter für eine bestimmte Bedeutung, ein bestimmtes Objekt in der Welt steht). Sie untersucht, was sprachliche Zeichen sind und wie sie in einer Sprache miteinander kombiniert und geordnet (= strukturiert) werden. Dabei sind verschiedene Strukturebenen zentral; z. B. Phonetik/PhonologiePhonetik/Phonologie (→ Lautstruktur), MorphologieMorphologie (→ Wortstruktur), SyntaxSyntax (→ Satzstruktur), SemantikSemantik (→ Analyse der Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken), PragmatikPragmatik (→ Analyse des Gebrauchs und der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in konkreten Äußerungssituationen) (vgl. Bußmann 2002: 640).
Die Sprachphilosophie ist ein Zweig der Philosophie und kann heute auch als eine Teildisziplin der Linguistik aufgefasst werden, historisch reicht sie jedoch sehr viel weiter zurück. Die Sprachphilosophie beschäftigt sich mit der Bedeutungsdimension von Sprache und deren Verhältnis zur Wirklichkeit. Ihr Untersuchungsbereich deckt sich damit zu großen Teilen mit dem der Semantik und Pragmatik. Genau betrachtet, waren Sprachphilosophen wie John L. Austin Wegbereiter für die Entwicklung von Semantik und Pragmatik in der modernen Sprachwissenschaft.
Vor Austin hatte sich die sprachphilosophische Tradition mit der Bedeutung von sprachlichen Äußerungen in erster Linie aus der Perspektive heraus beschäftigt, dass Äußerungen „wahrheitsfähige Gebilde“ (Hoffmann 2010: 155) darstellen. Ein Satz wie z. B. Mona sitzt auf dem Stuhl ist eine Aussage, die, wenn sie in einer bestimmten Situation geäußert wird, entweder wahr oder falsch sein kann. Ein möglicher Weg, die Bedeutung des Satzes zu fassen, ist zu sagen, dass wir die Bedeutung von Mona sitzt auf dem Stuhl verstehen, wenn wir genau wissen, in welchen Äußerungssituationen der Satz wahr ist und in welchen er falsch ist – wenn wir also die Wahrheitsbedingung en Wahrheitsbedingungen des Satzes kennen.
Austin bricht mit dieser Tradition, dass eine Aussage generell als etwas zu definieren ist, das entweder wahr oder falsch sein kann. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Bruch leistet sein Aufsatz „Performative und konstatierende Äußerungkonstatierende Äußerung“ (1962); eben hier expliziert Austin erstmals den Begriff performativ .
Читать дальше
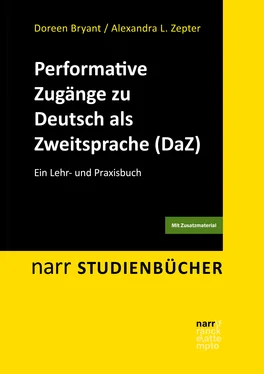
 Abb. 1.4:
Abb. 1.4: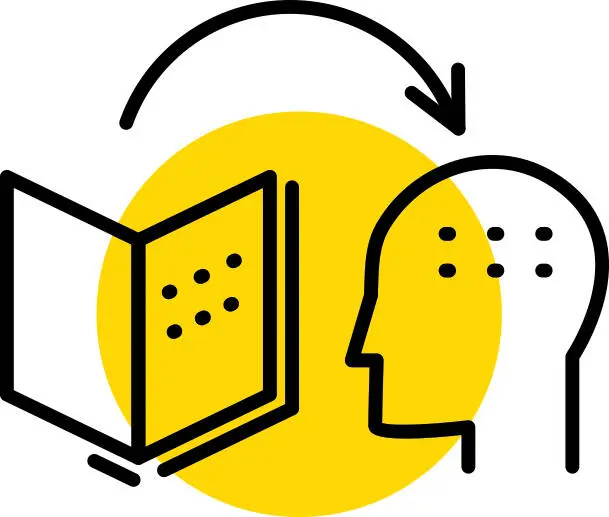 Sprachphilosoph ieSprachphilosophie vs. Linguist ikLinguistik
Sprachphilosoph ieSprachphilosophie vs. Linguist ikLinguistik