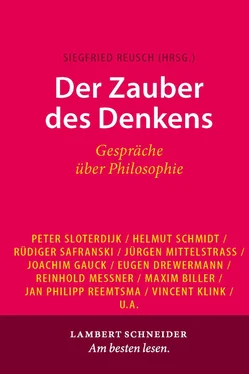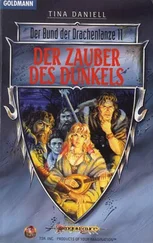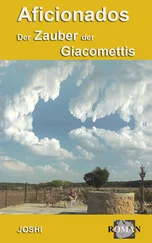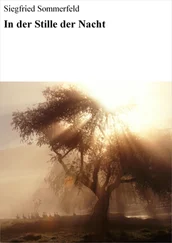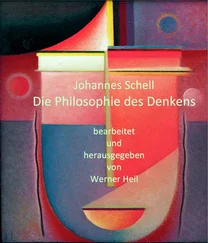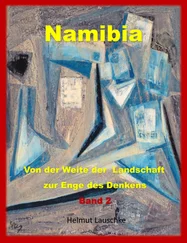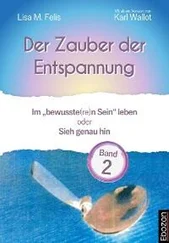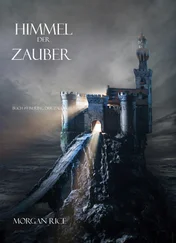Auf der anderen Seite würde ich auf meinem Feld nie eine reine Literatur verteidigen, die nicht über das Handwerkszeug des Fachs verfügt. Die Rezeptionsverweigerung, die in der deutschen akademischen Szene meiner Arbeit gegenüber hier und dort zu beobachten war, betrifft ja üblicherweise nicht das Handwerk, sondern den literarischen Mehrwert, der bei mir hinzukommt, und auf den sich einzulassen für den Homo academicus ein existenzielles Risiko beinhaltet. Ich selbst bin von guter Schulphilosophie begeistert, aber sie muss, denke ich, ihr Gegenlager in einer vitalen Zeitphilosophie haben, das heißt in einer Autorenphilosophie, die die intellektuelle Evolution mit vorantreibt. Ansonsten bereitet gerade der Akademismus den Untergang der Philosophie vor. Akademismus, das soll man nicht vergessen, kann eine Form von Dekadenz sein.
Sind Philosophen die Ärzte der Kultur, wie Nietzsche schreibt?
Das ist zu hoch gegriffen. Kulturen brauchen keine Ärzte, weil Kulturen als Ganzes nicht krank sein können, zumindest nicht im Sinn der Inneren Medizin. Aber sie weisen Haltungsfehler auf, die nach Korrektur verlangen. Die großen Orthopäden der jüngeren Philosophie – ich denke zum Beispiel an Husserl oder Heidegger oder Hermann Schmitz – arbeiten sich an den Fehlhaltungen der europäischen Rationalitätskultur ab. Und solch ein Fehlhaltungstheoretiker war in gewisser Weise auch Nietzsche, sofern er die durch das Christentum eingeführte moralische Verkrümmung des westlichen Menschen therapieren wollte.
Heidegger selbst wies im Übrigen alle Symptome einer typischen Philosophenkrankheit auf, nämlich zu glauben, die Bewegung des Weltgeistes vollziehe sich durch seine schreibende Hand beziehungsweise durch seinen akademischen Vortrag. Immerhin: Er war auch einer von denen, die vorgeführt haben, dass Philosophie, wenn sie bei der Sache ist, immer von einer anderen Kanzel als dem akademischen Lehrstuhl aus spricht.
Wie würden Sie das Verhältnis der Philosophie zur Wissenschaft bestimmen?
Diese Frage führt uns auf ein weites Feld. Philosophie ist selbst keine Wissenschaft. Sie ist so etwas wie eine Moderatorin oder Partnerin der Wissenschaft, in historischer Sicht auch eine Matrix der Wissenschaften – doch nicht diese selbst. Sie ist, wenn Sie so wollen, sogar in ihrer wissenschaftstheoretischen Ausprägung, bestenfalls so etwas wie ein Wissenschaftsrat. Aber sie kann und soll keine Wissenschaft sein, weil sie eine ganz andere Funktion ausübt. Ich erinnere noch einmal an die Tradition der Philosophie als Modus vivendi, in der es immer einen klaren Primat der Lebensberatung gab. In der Antike wurde wissenschaftliche Betätigung immer nur so weit betrieben, wie sie nötig war, um die Therapie der Seele voranzubringen.
Bleibt da noch Raum für überzeitliche Wahrheiten?
Ja, selbstverständlich, wenn man Wahrheit als Eigenschaft von Sätzen versteht. Sätze sind überzeitlich wahr, weil und insofern es so etwas wie unverwüstliche Sätze gibt, die noch länger da sein werden, als Atommüll in Endlagern strahlen kann. Die wahren Sätze strahlen immer, die euklidischen Gesetze oder die Winkelsumme im Dreieck, die braucht man nicht in einem alten Salzbergwerk aufzubewahren, sie strahlen auf eine Weise, die mit unserem Dasein im alltäglichen Biotop bis zum Beweis des Gegenteils kompatibel zu sein scheint. Dasselbe gilt auch für historische Sätze. Nach allem, was wir wissen, wurde Cäsar an den Iden des März ermordet, und eine richtige Beschreibung dieses Vorgangs – egal wieviel daran von den Redakteuren stammt – bleibt für den Rest der Zeiten wahr. Es ist nicht so, dass wir eines Tages erklären müssten: Im Lichte neuerer Erkenntnisse oder durch eine Veränderung der Perspektive verändert sich das, was damals passiert ist, von Grund auf – und Caesar wurde an den Kalenden des Januar ermordet. Keine Sorge, die Interpretationen verändern sich, aber es gibt eine relativ entrückte Dimension. Ich bin, wie Sie sehen, kein Anhänger des radikalen Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, dass alles nur durch meine grammatischen Entscheidungen und unsere kollektiven Verabredungen konstruiert wird. Ich neige eher zu einer konventionell realistischen Ontologie. Andererseits meine ich, wir wissen vielleicht noch gar nicht, wie viele Ontologien es geben muss. Es könnte zehn verschiedene Ontologien für jeweils verschiedene Dimensionen geben – eine für Zahlen, eine für geometrische Figuren, eine für Sachverhalte, eine für einzelne Ereignisse, eine für Ereignisströme, eine für Maschinen, eine für Personen, eine für Kunstwerke, eine für Götter, eine für Tiere und so weiter.
Edmund Husserl war bestrebt, Philosophie als strenge Wissenschaft zu etablieren. War dies eine Fehlentwicklung in der Philosophiegeschichte?
Nein. Husserl schneidet aus dem Feld der Philosophie nur einen bestimmten Ausschnitt heraus. Dabei kommt es, zugleich mit einer Bereicherung an Präzision, zu einer fantastischen Verarmung des Gegenstandsbereichs der Philosophie. Es entsteht so etwas wie ein In-vitro-Denken, bei dem der Anspruch auf Verwissenschaftlichung gewiss ein Stück weit vorangetrieben werden konnte. Insofern war das kein Irrweg, aber diese Art des Philosophierens taugt nicht dazu, alle philosophischen Stile zu monopolisieren. Wir kommen von Husserl aus nur mit größter Mühe zu einer Sozialphilosophie, und die Welt der geschichtlichen Dinge hat Husserl, wie er selber einmal bemerkte, einfach vergessen.
In Ihren Werken spielt der Begriff der Gestalt eine große Rolle. Sie interessieren sich für Gestaltentwicklungen, Formen und Transformationen.
Das ist richtig. Ich hätte die Sphären nicht geschrieben, wenn ich geglaubt hätte, dass die Alternative, vor welche die traditionelle Philosophie uns hinsichtlich geistiger Objekte stellt, eine überzeugende wäre. Es gibt neben den Ideen, den Zahlen und den Begriffen eben noch etwas anderes – und das sind die Formen im Sinn von Gestalten. Der Formbegriff hat zwar in der Philosophie eine große Rolle gespielt, aber die Formen als solche kamen dennoch zumeist gar nicht vor. Man hat sich auf den Formbegriff berufen, um begriffliche Verallgemeinerungen zu propagieren. Die Form als Form hingegen hat die Philosophen kaum interessiert. Ich könnte Ihnen kaum einen Philosophen der Neuzeit nennen, der zu den platonischen Körpern (die „regulären“ Vielecke wie zum Beispiel Würfel, Tetraeder, Dodekaeder und so weiter) etwas Belangvolles zu sagen wusste. Außer Leibniz und ein paar Denkern, die an ihn angeknüpft haben, wie Dietrich Mahnke, war da praktisch niemand, der in den letzten 200 Jahren zu Kugeln etwas Sinnvolles beigesteuert hätte. Die Scholastik kennt die Lehre von der Zahl und die Lehre vom Begriff. Aber diese Alternative ist alles andere als vollständig. Dass sich zwischen der Zahl und dem Begriff der Zwischenbereich der Formen auftut, das ist die starke These, der ich nachgehe. Unter den Rezensenten meines Sphärenprojekts traten Leute auf, die dumm genug waren, das Wort Kugel nur eine Metapher zu nennen. Doch wenn ich den Ausdruck in den Sphären metaphorisch gebrauchte, dann habe ich das gekennzeichnet. Aber fürs Erste sind Kugeln keine Metaphern, sondern Formen.
Woher rührt diese Formvergessenheit in der Philosophie?
Die noch ärger ist als die berühmte Seinsvergessenheit – die übrigens von Heidegger stark überschätzt wurde. Ich meine, dieser Defekt hat mit dem Begriffsglauben der Philosophen zu tun, auch damit, dass die moderne Erkenntnistheorie fatale Konsequenzen nach sich gezogen hat, weil sie die synthetischen Urteile a priori in den Verstand gelegt hat; wohingegen Formen die Information enthalten, dass die Synthesis nicht erst im Verstand passiert. Das heißt, die wirkliche Form ist eine empfangene Form, die nicht von mir kommt. Ich denke zur Kugel ja nicht die Kugelgestalt im Verstand hinzu, sondern finde sie als eine formale Eigenschaft des Objekts vor. Das kann als nicht ideales oder als ideales Objekt auftreten, aber es hat in jedem Fall die gegebene Form, wenn es sie eben hat. Durch den Transzendentalismus haben wir den ganzen Bereich des Morphologischen, den Bereich der Formen und der Formentstehung, hinweg eskamotiert. Es gibt zwar immer wieder Versuche, die Form, die Gestalt auch vom Ding her zu denken, aber als bloßer Kantianer könnte ich dazu keine drei vernünftigen Sätze sagen. Genau dieses Problem greift die Sphärenthematik des zweiten Bands der Sphärentrilogie auf, in dem der Begriff der Kugel überwiegend nicht metaphorisch verwendet wird.
Читать дальше