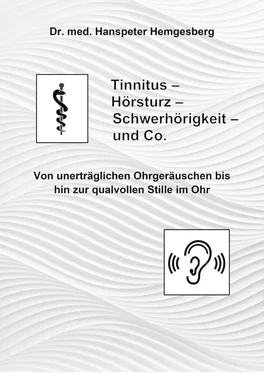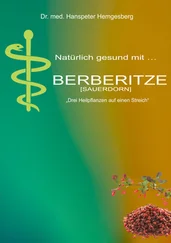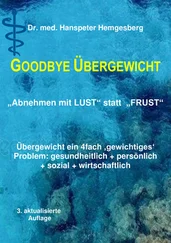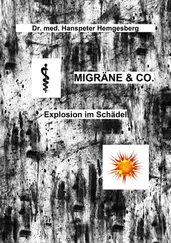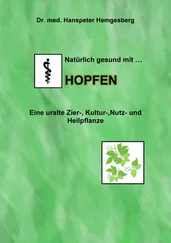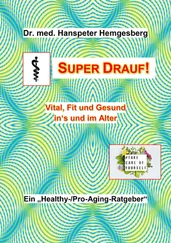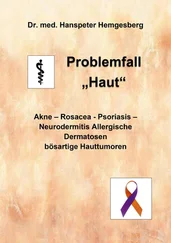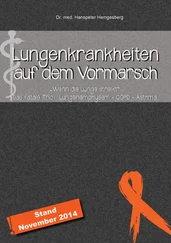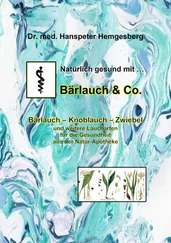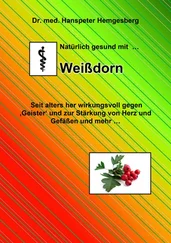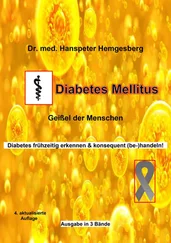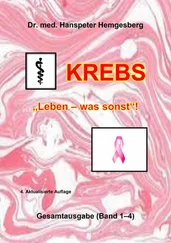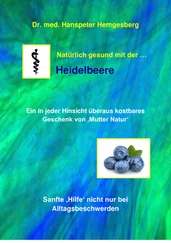durch Gefäßspasmen (z.B. im Rahmen einer vestibulo-cochleären Migräne)
Störungen der Balance der Stoffwechsel-Prozesse im Endolymph-
Organ durch erbliche, anatomische und/oder traumatische Faktoren
Herderkrankungen an Hals & Kopf mit Auswirkung(en) auf das Innenohr
Störungen/Fehlstellungen/Fehlfunktionen der Halswirbel- und Kiefer-
Gelenke
Wirbelsäulenerkrankungen auch/oder an Brust und Rücken,
die ihrerseits die vegetative Nervenversorgung im Endolymphorgan verschlechtern
Seelische (psychische) Reaktionen und Dysregulationen;
ebensolche
soziale/psychosoziale Verwerfungen und insbesondere auch
Stress
Toxische Belastungen (z.B. Umweltgifte, belastende Zahnmaterialien, Freie
Radikale, Oxidativer Stress), welche eine unmittelbare Auswirkung auf den Stoffwechsel des Endolymphorgans haben
Damit ich es nicht „vergesse“:
Der M. Ménière ist absolut keine Erkrankung der „modernen Jetzt-Zeit“!
Weit gefehlt.
Es dürfte gesichert sein, dass so bekannte wie berühmte Männer wie Vincent van Gogh, Martin Luther, Jonathan Swift und auch Julius Cäsar unter und am Ménière’schen Symptomenkomplex gelitten hatten.
Zurück zum Thema.
Fakt ist:
Das Gesamt-Beschwerdebild ist die Folge einer Erkrankung des ‚häutigen Labyrinths’, vor allem des Vestibularis-Apparates – der Bogengänge – im inneren Ohr. Diese - den M. Ménière auslösende, bewirkende und auch unterhaltende - Erkrankung ist immer vergesellschaftet mit einer generalisierten Ausweitung des membranösen Labyrinths & mit Ausbildung eines „endo-lymphatischen Hydrops“.
Durch diesen Hydrops kommt es zum Riss (Ruptur) der Reissner’ schen Membran (= untere Umkleidung im Schneckengang) und dadurch zum Ausfließen der Endo- in die Perilymphe.
Folge:
Dies löst dann schlag- und kettenreaktionsartig die Trias der klassischen Ménière-Symptomeaus:
1. Drehschwindel
2. Schwerhörigkeit
3. Ohrensausen
Diese „Ménière-Trias“ wird zum „Ménière-Quartett“ durch die zumeist zusätzlich vorliegenden Begleitbeschwerden, die
4. Vegetativ-funktionelle Symptome bedingt durch Nystagmus.
Die Schwindel-Attacken treten„schlag- und explosionsartig“ auf.
Es handelt sich dabei um einen „Drehschwindel“ .
Dieser Schwindel kann dauern von einigen wenigen Minuten bis zu etlichen Stunden und (in sehr seltenen Fällen) auch 1-2 Tage. Dann lässt der Schwindel langsam an Intensität nach und verschwindet allmählich gänzlich!
Es gibt Menière-Kranke, die nur wenige Anfälle in ihrem Leben erdulden müssen, ohne dass eine bleibende Schwerhörigkeit entsteht, bei anderen Erkrankten verläuft die Erkrankung oft schubweise über Jahre, wobei im Laufe der Zeit meist auf dem betroffenen Ohr eine mittel- bis hochgradige Schwerhörigkeit auftritt und bestehen bleibt.
Das Hörvermögen wird parallel zum Schwindel ebenfalls mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen. Es kommt zur (einseitigen) Schwerhörigkeit und zwar handelt es sich um eine ‚senso-neurale Schallempfindungs-Schwerhörigkeit vom cochlearen Typ’.
Im Tonaudiogramm findet sich charakteristischerweise die „typische Ménière-Wanne“. Außerdem findet sich ein „positives Recruitment“ (= der Lautheitsausgleich bei Schwerhörigkeit; d.h. starke Schallreize werden trotz der erhöhten Hörschwelle auf dem erkrankten Ohr ebenso laut [und oft sogar lauter] empfunden wie auf dem gesunden Ohr).
Das Hörvermögen des erkrankten Ohres schwankt – von leichtgradiger und nur kurze Zeit bestehender Hörminderung bis zum massiven Hörverlust –. Mit Fortdauer der Erkrankung (bzw. mit wiederholten Schwindel-Attacken) neigt das Gehör allerdings zu fortschreitender Verschlechterung. Dies kann (und führt auch dazu) in schweren Verlaufsfällen bis zur völligen Taubheit auf der betroffenen Ohrseite (z.B. so beim berühmten deutschen Komponisten, Ludwig van Beethoven) führen!
Das Ohrgeräusch im Sinne von Ohrensausen (Tinnitus aurium – s. später) wird subjektiv zumeist wahrgenommen als ein dumpfes und tiefes Brummen oder auch als zischende Geräusche. Dieses Geräusch kann dabei entweder konstant oder intermittierend sein und sich sowohl vor, als auch während und/oder nach dem Schwindelanfall verschlimmern.
In vielen Fällen kündigt der Tinnitus den Ménière-Anfall an!
Mit Einsetzen des Schwindels treten auch die vegetativ-funktionellen Symptome bedingt durch Nystagmus schlagartig auf.
Bei dem Nystagmus [= „Augenzittern“] handelt es sich zu allermeist um einen sogen. horizontalen Spontan-Nystagmus und meist zur kranken Seite hin.
Das bedeutet:
Bereits in Ruhestellung - Augen in Fernblickstellung - kommt es zum Auftreten von unwillkürlichen und rhythmischen Augenbewegungen und zwar mit einem „Augenzittern“ , wobei einer langsamen Bewegung auf der einen Seite eine schnellere nachfolgt , die zudem in der entgegen gesetzten Richtung erfolgt auf der anderen Seite; und nach der schnelleren wird der Nystagmus benannt.
Eine zweite Variante ist ebenfalls möglich:
Es kommt zu gleichmäßig pendelnden, wellenartigen Bewegungen (= undulierender Nystagmus).
Was die Intensität angeht, so kann es sich um einen fein-, mittel- und grobschlächtigen Nystagmus handeln. Stets handelt es sich beim M. Menière um einen horizontalen (was die Ebene angeht) und um einen spontanen Dreh-Schwindel (was die Schwindelform betrifft).
In sehr vielen Fällen kommt es zur Ausbildung eines spezifischen Phänomens, des sogen. Dandy-Syndroms (benannt nach dem US-amerikan. Neurochirurgen Dandy).
Das heißt:
Bei Bewegungen des Kopfes scheinen sich feststehende Gegenstände zu bewegen .
Bedingt durch den Nystagmus einerseits und den Schwindel andererseits werden dann die vegetativ-funktionellen Symptome ausgelöst. Zumeist sind dies: Sehstörungen (als unmittelbare Folge des Nystagmus) und dann Brechreiz/Übelkeit/Erbrechen; aber auch Hypersalivation (= vermehrter Speichelfluss), Hyperhidrosis (= starke Schweißausbrüche), Diarrhoe (= Durchfall), Blässe und Kopfschmerzen.
Nicht wenige Betroffene klagen über ein wechselndes ‚Verstopfungs- und Druckgefühl’ im betroffenen Ohr .
Beim sogen. Lermoyez-Syndrom - benannt nach dem französ. HNO-Arzt Marcel Lermoyez (1858-1929) - handelt es sich um eine seltene Innenohr-Erkrankung; wie der M. Ménière mit anfallsartigem Charakter. Von einigen Wissenschaftlern wird er als ‚Variante‘ des M. Ménière angesehen - als sogen. „symptomatischer M. Ménière“ - und nicht als eine eigenständige Erkrankung.
Die Symptomatik beim M. Lermoyez ähnelt der des M. Ménière.
Die Patienten leiden während des Anfalls unter Drehschwindel, teilweise mit Tinnitus. Und:
Eine bereits bestehende Schwerhörigkeit bessert sich jedoch im akuten Anfall.
Lermoyez beschrieb 1919 Menière-Patienten, bei denen die typische Symptomatik in sogen. umgekehrter Reihenfolge auftraten. Ohrgeräusche und Hörverlust traten vor den Gleichgewichts-Erscheinungen auf. Die anfängliche Hörminderung verstärkt sich, bis starker Schwindel einsetzt.
In kurzer Zeit erholt sich dann das Gehör jedoch.
Wenn es sich beim M. Lermoyez nicht um die Vorstufe der eigentlichen Ménière-Erkrankung handelt, dann lassen sich die Ursachen suchen und finden in Ohr-Erkrankungen (chron. adhäsive Mittelohrprozesse, Tubenstenose, nicht-eitrige Erkrankungen des Innenohrs; aber auch Lues = Syphilis, Leukämie, Arteriosklerose mit Kreislaufstörungen, Hirntumoren, Multiple Sklerose, hormonelle Dysfunktionen, oder auch allergische und/oder toxische Schädigungen [u.a. Alkohol, Nikotin, Drogen], Infektionsherde, u.a. ...).
Читать дальше