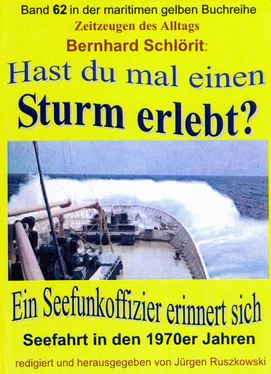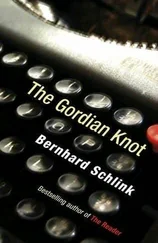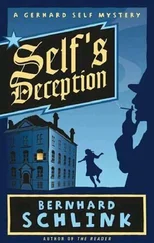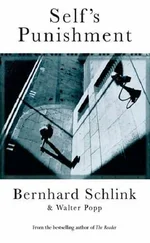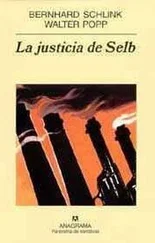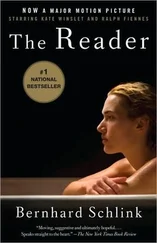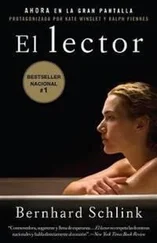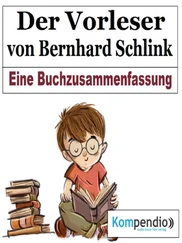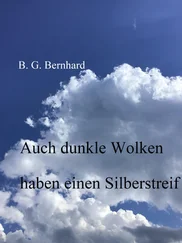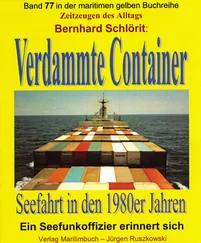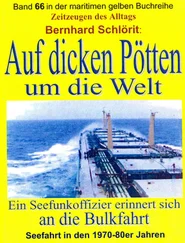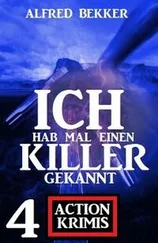Dazu muss ich ein wenig weiter ausholen. Zu dieser Zeit gab es vier verschiedene Befähigungszeugnisse, die zur Teilnahme am Seefunkdienst berechtigten. Das Seesprechfunkzeugnis war obligatorisch für alle nautischen Offiziere, auch Sportskipper erwarben es, damit durfte Sprechfunkdienst wahrgenommen werden. Für Berufsfunker war es praktisch in ihr Patent integriert. Die Ausbildung wurde zum Teil in Abendkursen angeboten. Das Seefunksonderzeugnis galt als Mindestanforderung für ‚hauptamtliche’ Funker, es war für den Einsatz auf Schiffen gedacht, die eigentlich gar nicht telegrafieausrüstungspflichtig waren, aufgrund ihres besonderen Einsatzes aber eine solche Station fuhren, Bergungsschlepper und Fischereifahrzeuge zum Beispiel. Dieses Zeugnis konnte man in sechsmonatigen Kursen erwerben. Erst das Seefunkzeugnis 2. Klasse berechtigte zum Dienst auf Frachtern aller Größen und in allen Fahrtgebieten, der Erwerb setzte eine abgeschlossene Berufsausbildung im Elektrofach und einen dreisemestrigen Besuch der Seefahrtschule voraus. Anstatt einer Berufsausbildung wurde auch ein zweijähriges Praktikum in der Elektrobranche anerkannt. Dieses Patent konnte in einem zusätzlichen Lehrgang auf 1. Klasse aufgestockt werden, damit durfte man auf Passagierschiffen oder bei Küstenfunkstellen arbeiten. Und mit diesen beiden Zeugnissen agierte der Inhaber auch unter der Berufsbezeichnung „Funkoffizier“, er trug bei zweiter Klasse zwei und bei erster Klasse drei Streifen an der Uniform und zählte damit zur Kaste der Handelsschiffsoffiziere.
Aufgrund des permanenten Funkermangels war es aber zur Regel geworden, Sonderzeugnisfunkern per Ausnahmegenehmigung den Dienst auf Frachtschiffen aller Größen und Fahrtgebiete zu erlauben. Infolge dieser langjährigen Praxis wimmelte es bei der Seefahrt von Sonderzeugnisinhabern, viele ehemalige Bundeswehrfunker, Seeleute aus der Mannschaftsebene, Funkamateure und sogar Ehefrauen von nautischen und technischen Schiffsoffizieren nutzten die Möglichkeit, nach sechs Monaten Lehrgang diesen Job zu ergattern. Wobei die Durchfallquote aber recht hoch war, sechs Monate sind verdammt wenig, um einen brauchbaren Funker zu produzieren.
So, und nun sollte diese Regelung nicht mehr zur Anwendung kommen, man wollte nur noch Funkoffiziere mit dem Seefunkzeugnis 2. Klasse oder dem höherwertigen Zeugnis 1. Klasse akzeptieren. Den Inhabern der Sonderzeugnisse wurde eine Übergangsfrist zum Erwerb der 2. Klasse eingeräumt, und das war es dann.
Für den Erwerb des 2.Klasse-Zeugnisses besaß ich weder die erforderliche Berufsausbildung noch ein gleichwertiges Praktikum. Da stand nun der abgeschmetterte Funkerkandidat und guckte dumm aus der Wäsche.
Die Pläne in Sachen Seefahrt hatten sich in Luft aufgelöst, eine Alternative musste her.
Eine Reifenhandlung in der Heimatregion suchte einen Verkaufsfahrer, zur Überbrückung kam das gerade recht. Diesbezügliche Sachkenntnisse fehlten völlig, mir war lediglich bekannt, dass Reifen rund, aus Gummi und zum Fortkommen eines Autos sehr vorteilhaft sind. Somit war für einige Monate der vermutlich erfolgloseste Verkaufsfahrer Südhessens im Großraum Darmstadt unterwegs. Mehr und mehr drängte sich der Gedanke auf, vielleicht doch die zwei Jahre Praktikum in Kauf zu nehmen, um die Voraussetzungen für den Besuch der Seefahrtschule zu schaffen. Aber zwei Jahre können verdammt lange dauern, besonders, wenn man jung ist. Und dann waren ja auch noch drei Semester Schulbesuch zu absolvieren. Dreieinhalb Jahre also. Und was tun, wenn ich das alles durchzog und hinterher feststellte, dass die Seefahrt doch nicht meine Welt war? Es gab ’ne Menge zu grübeln in jenen Tagen.
Nach längerer Orientierungsphase kam mir dann eine besonders tolle Idee, zumindest hielt ich meine Kopfgeburt für so was. Es müsste doch möglich sein, irgendwie bei einer Reederei so eine Art „Schnupperreise“ zu absolvieren, ein Bordpraktikum oder etwas Ähnliches. Auf dem heimischen Postamt lagen die Telefonbücher der ganzen Republik, nichts wie hin, die Adressen mir bekannter Reedereien müssten ja da drin stehen. Das waren gerade mal drei, Hapag-Lloyd, DDG Hansa und Frigga. Letztere antwortete gar nicht, Hansa lehnte dankend ab und Hapag-Lloyd bot mir in einem kurzen Schreiben eine Anstellung als Aufwäscher an. Keine Ahnung, was ein Aufwäscher zu tun hatte, egal, nun würde es mit der Seefahrt klappen. Ich kontaktierte die in dem Brief aufgeführte Telefonnummer und wurde umgehend nach Bremen einbestellt. Seefahrt, Schlörit kommt, zweiter Anlauf…

Der Einstieg… – Ein Aufwäscher geht an Bord
Hapag-Lloyd, damals Deutschlands größte und bei Landratten auch bekannteste Reederei, war erst 1970 durch Fusion der beiden traditionsreichen Unternehmen Norddeutscher Lloyd (Bremen) und Hapag (Hamburg) entstanden. Eigentlich standen beide Firmen immer in heftiger Konkurrenz zueinander, dieser Geist hatte auch die Besatzungen durchdrungen, und je nach Standort wollte man diesen Hamburgern oder Bremern nichts zu tun haben. Es brauchte noch einige Jahre, bis aus beiden Reedereien wirklich eine Company geworden war. 1972 gab es teilweise getrennte Verwaltungsbereiche, und das alte Lloyd-Heuerbüro im Bremer Überseehafen existierte auch noch. Dort stand ich an einem nasskalten Januarmorgen vor einem gewissen Herrn Pauli, der die Lloyddampfer (und damals nur diese) mit Mannschaftsgraden bemannte. Meine Einstellungsprozedur war denkbar kurz, mit einer Art Laufzettel ging es zum Vertrauensarzt der See-Berufsgenossenschaft, der untersuchte den hoffnungsvollen seemännischen Nachwuchs und stellte dann die obligatorische Gesundheitskarte aus, dazu noch den so genannte ‚Seuchenpass’, wenn die Verwendung im Bedienungssektor vorgesehen war. Wieder bei Pauli gelandet, folgte die Frage, ob man gerade polizeilich gesucht würde. Nach meinem Kenntnisstand war das nicht der Fall. Auf meine Frage, was denn bitteschön ein Aufwäscher eigentlich zu tun hatte, lautete die kurze Antwort: „Na, saubermachen halt. Geschirr spülen, Gänge feudeln und so’n Kram.“ Aha!
Dann überreichte mir Pauli mein Seefahrtsbuch, wichtigstes Dokument überhaupt, um Arbeit auf einem Schiff zu finden. Neben persönlichen Daten und einem Passbild enthielt es auf vielen Seiten Raum für Visa und Vermerke sowie die Eintragung aller Borddienstzeiten, die ich jemals leisten würde. Mir schien es in dem Moment das kostbarste Dokument zu sein, das ich besaß.
„So“, meinte Pauli abschließend, „Nun fahren ’se mal wieder nach Hause, wir schicken ein Telegramm, wenn’s dann soweit ist“ Das war es dann.
Nach Hause zurückgekehrt, meldete ich meinem Freundeskreis Vollzug in Sachen beginnender Seefahrtskarriere und lud umgehend zu einer feuchtfröhlichen Abschiedsfeier, schließlich konnte jeden Moment das angekündigte Telegramm eintreffen. Dass in der christlichen Seefahrt die Uhren etwas anders tickten, hatte mir niemand vermittelt. Wir haben dann acht Wochen lang immer wieder mal sehr intensiv Abschied gefeiert, allmählich schmolz meine Barschaft dahin, dafür stiegen die Leberwerte.
Endlich, als ich schon fast nicht mehr daran glaubte, trudelte ein Telegramm ein, kurzer Text: DIENSTANTRITT MIT ALLEN EFFEKTEN 27.03.72 MS BURGENSTEIN HALO BREMEN +. Was bitteschön waren Effekten? Keine Ahnung, was das nun wieder sollte, aber der zum Dienst einberufene Seelord packte seinen Bundeswehr-Seesack, davon ausgehend, dass ein Seesack das allgemein übliche Verpackungsmöbel für Seeleute sei. An Bord stellte sich heraus, dass der frisch gestrickte Aufwäscher der einzige Verwender dieses Traditionsgepäcks war, Hein Seemann reiste 1972 schon mit Koffer und Reisetasche. Und übrigens, mit Effekten war lediglich meine persönliche Ausrüstung gemeint… Aber der Reihe nach.
Читать дальше