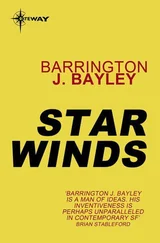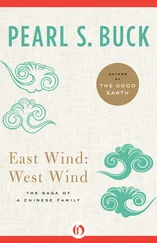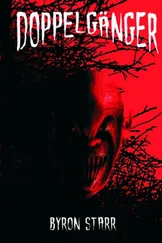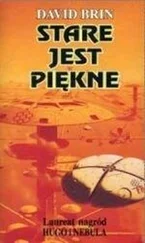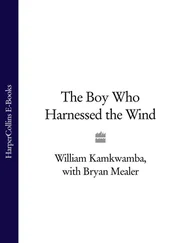Herr Rothe hatte sich etwas abseits auf einen freien Platz gesetzt und wurde immer nachdenklicher. Der Arzt hatte ihm ja schon von den beängstigenden Fakten zu dieser Krankheit berichtet und er las auch Zeitung. Aber was er hier zu hören bekam, einschließlich der Geschichte von der kleinen Luci, das berührte ihn unerwartet tief. Emma war das erste Kind hier im Dorf, das von dieser Krankheit heimgesucht wurde. Zum ersten Mal kamen ihm deren konkrete, handfeste Folgen so nah.
Als Emma endete, herrschte betretenes Schweigen im Raum. Emma stand auf, nahm ihre Krücken, ging langsam zurück zu ihrem Platz und setzte sich dort wieder.
Erst jetzt erhob sich Herr Rothe und ging nach vorn. Er blieb vor der Tafel stehen und blickte erneut in die Gesichter all dieser ihm anvertrauten Mädchen. Sie spiegelten Trauer, Entsetzen, Angst, ungläubiges Staunen, hier und dort wohl auch heimliche Schadenfreude, die ganze Palette menschlicher Emotionen angesichts eines solchen Unglücks.
Er räusperte sich.
"Emma, wir alle danken dir für deinen sehr lebendigen Bericht. Gibt es noch Fragen? Nein? Dann kommen wir jetzt zum Unterricht."
Nein, im Moment hatte niemand Fragen. Die würden vielleicht später kommen, wenn sie das Gehörte einigermaßen verdaut hatten. Einstweilen waren sie froh, sich wieder alltäglichen Dingen zuwenden zu können und am Ende des Tages stellte Herr Rothe fest, dass die Mädchen dem Unterricht schon lange nicht mehr so ruhig und diszipliniert gefolgt waren.
Danach normalisierte sich der Alltag für Emma wieder. Sie hatte in der Schule einiges nachzuholen. Herr Rothe versah sie mit extra-Aufgaben und hieß eines der Mädchen ihrer Klassenstufe, ihr zwischendurch leise bei deren Lösung zu helfen, ihr dies und das zu erklären. Hätte der Lehrer auch nur versucht, das selbst zu tun, wäre ihm die Hundertschaft Mädchen durchgegangen wie eine Herde junger Pferde. Emma kam mit Hilde, so hieß das Mädchen, gut zurecht, und ganz allmählich konnte sie dem Unterricht wenigstens phasenweise wieder folgen. Wenn sie die Zeit über den Winter gut zum Lernen nutzte, durfte ihrer Versetzung in die nächste Klassenstufe nichts entgegenstehen.
Was sie allerdings störte, war, dass sie nach der Schule, die spätestens mittags um 13.00 Uhr endete, kaum bei der Ernte helfen konnte, jedenfalls nicht draußen auf den Feldern. Dafür war sie mit ihren Krücken zu unbeweglich. Kurze Wege wie zum Müller nebenan oder zu ihrer Tante Thea zwei Querstraßen weiter bewältigte sie inzwischen schon ohne Gehhilfen, aber die Wege zum Bäcker, zum Schlachter oder in die Schule waren noch zu weit.
Als aber die Früchte im Garten in Massen reiften und die große Zeit des Einweckens anstand, konnte auch sie sich vor Arbeit nicht retten, so wie die anderen Dörfler auch. Das Pflücken erledigte zum größten Teil ihre Mutter. Nur bei etwas höher gewachsenen Sträuchern wie Stachelbeeren und Johannisbeeren konnte Emma das, gestützt auf ihre Krücken, übernehmen. Insbesondere das Stachelbeerpflücken war wegen der vielen Dornen an den Sträuchern nicht sehr beliebt. Emma machte das
nichts aus, denn sie hatte da ihre eigene Technik. Sie fing oben am Strauch an, fasste einen der oberen Zweige vorsichtig an dessen Ende und bog ihn ein Stück nach oben. So konnte sie die nach unten hängenden Früchte erreichen, ohne ständig gepiekt zu werden. War dieser Zweig abgeerntet und so von seiner Last befreit, reckte er sich von allein in die Höhe, so dass nun die darunter liegenden Zweige gut zu erreichen und die Früchte mit derselben Methode gefahrlos zu pflücken waren.
Ein paar der frischen Früchte durften aus der Hand gegessen werden, einige, so auch etliche der Stachelbeeren, landeten hin und wieder auf einem Kuchenteig, um die Sonntagskaffeetafel zu bereichern. Das meiste Obst und Gemüse wurde jedoch verarbeitet und haltbar gemacht, denn es musste sie über den Winter und bis zur nächsten Ernte ernähren. Stunde um Stunde verbrachten Emma und ihre Mutter damit, Erbsen auszupalen, grüne und gelbe Bohnen zu brechen und von ihren Fäden zu befreien, Möhren zu schrapeln, Obst von Steinen und Kerngehäusen zu befreien und zu zerkleinern. Satz um Satz gefüllter Einweckgläser wanderte in den Backofen, um dort gründlich durcherhitzt zu werden. Das zerkleinerte Obst kam zu einem Teil mit reichlich Zucker vermischt in große Töpfe und wurde dann auf kleiner Flamme stundenlang zu Marmelade gerührt, in kleine Gläser gefüllt, mit Cellophan und etwas Natron bedeckt und mit noch einem Blatt Cellophan verschlossen. Gurken und gekochte Kürbisstücke wurden mit Essig und verschiedenen Kräutern und Gewürzen sauer oder süß-sauer eingelegt.
Als die grünen Stangenbohnen reif waren, mussten diese nach dem Abziehen der Fäden mit einem kleinen scharfen Messer schräg in möglichst lange und dünne Scheibchen geschnippelt werden, eine mühsame Aufgabe, die viel Geduld und eine sichere Hand erforderte. Als Emma den ersten großen Korb voll verarbeitet hatte, war sie Expertin darin. Selbst ihre Mutter warf einen anerkennenden Blick darauf und zeigte ihr, wie die hauchdünnen Blättchen weiter zu verarbeiten waren. Portionsweise tat sie diese in eine große flache Schüssel, streute reichlich Salz darauf und knetete sie so lange, bis der Saft austrat und sich die Bohnen schon viel weicher anfühlten. Emma tat es ihr gleich. Am Ende hatten sie einen großen Eimer voller grüner Bohnenpampe, erstaunlich wenig, gemessen an der Menge Bohnen, die Emma geschnippelt hatte. Nun befüllten sie eine Reihe kleiner Tonkrüge damit, deckten die Masse mit einem passenden Teller ab und beschwerten diesen mit einem Feldstein.
Runde sechs Wochen später waren die Bohnen durchgegärt und mindestens ein halbes Jahr haltbar. Sollten sie gegessen werden, wurde dem Topf die passende Portion entnommen und erstmal in Wasser gelegt, um das überschüssige Salz auszuspülen. Der dann mit Rind- oder Schweinefleisch, Kartoffeln und Gemüse bereitete Eintopf schmeckte wunderbar, wohlgemerkt ohne das allzu oft ekelhaft seifig schmeckende Bohnenkraut. Ein wahres Festessen wurden die Schnippelbohnen jedoch, wenn sie gekocht und anschließend kurz in heißer Butter geschwenkt wurden. Das sollte Emmas Spezialität werden, eine köstliche Beilage zu allem Gebratenen.
Emma und ihre Mutter entsteinten gerade die ersten reifen Pflaumen des Jahres, als es heftig an der Vordertür klopfte.
"Ja, ja, ich komm ja schon!" rief Emmas Mutter, zur Tür eilend, während sie ihre Hände flüchtig an ihrer Schürze abwischte und die Tür öffnete. Der junge Herr Bruns, einer der Gesellen des Schmiedemeisters an der Brücke, drehte verlegen seine Schiebermütze in den Händen.
"Ich glaube, es ist soweit."
Seine Frau Elfriede, kurz Elli genannt, mit der er seit knapp zwei Jahren verheiratet war, lag also anscheinend ziemlich pünktlich in den Wehen. Emmas Mutter nickte.
"Augenblick, ich hole meine Sachen."
Während sie in der Küche ihre Schürze abstreifte, sich eilig die Hände wusch und ihre für diese Zwecke bereit stehende Tasche ergriff, meinte sie zu Emma:
"Wenn du damit fertig bist, ist schon fast Zeit für das Abendbrot. Ich weiß nicht, wann ich zurück sein werde, aber du weißt ja, was zu tun ist."
Emma nickte. Immer wieder wurde ihre Mutter zu einer Hochschwangeren gerufen. Manchmal war das Kind dann Stunden später da, manchmal war es falscher Alarm und der Nachwuchs ließ sich nach den ersten Senkwehen noch ein, zwei Tage Zeit. Ihre Mutter betreute außerdem die Wöchnerinnen, besuchte sie regelmäßig bei einer Runde durch das Dorf oder eilte außerplanmäßig zu ihnen, wenn sich Komplikationen einstellten. Immerhin musste sie so nicht regelmäßig mit auf die Felder, jedenfalls nicht außerhalb der Aussaat- und der Erntezeit, und dann nicht, wenn genügend andere Arbeitskräfte zur Verfügung standen.
Читать дальше