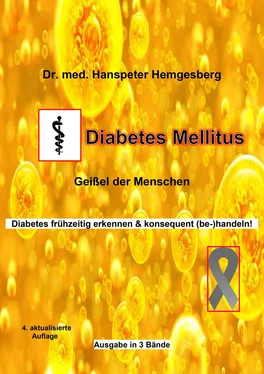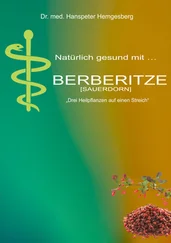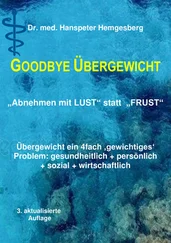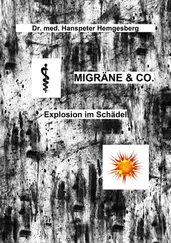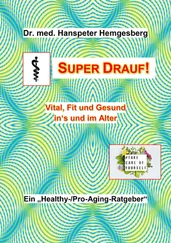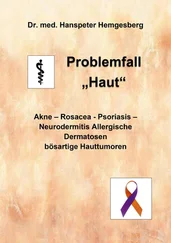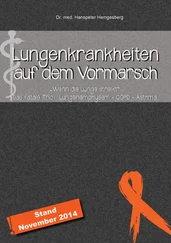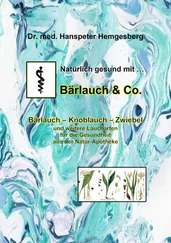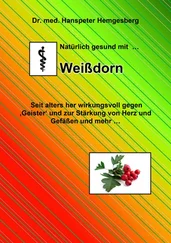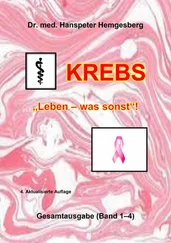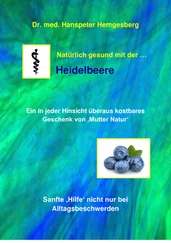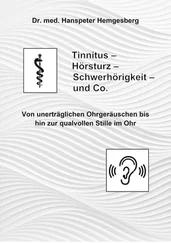„ Diabetes ist eine rätselhafte Erkrankung.Die Krankheit ist nicht sehr häufigund besteht in einem Zerfließendes Fleisches und der Glieder zu Urin .”
So beginnt der griechische Arzt Aretaios von Kappadokien (81 – 138 n.Chr.) seine klassische Betrachtung über den Diabetes.
Von der Antike bis in die Gegenwart wird von dieser Krankheit berichtet.
Das medizinische Wissen hat sich seitdem deutlich erweitert, das Leiden der Patienten hat sich vermindert, aber die Erkrankung ist viel häufiger geworden.
Ein anderer berühmter griechischer Arzt, Galen von Pergamon (ca. 130-210 n. Chr.) – genannt Galen –, sah in Diabetes ein Nierenleiden.
Die Therapie hieß für Galen:
Überwindung der Säfteschärfe, Verlangsamung der Blutbewegung, Kühlung der Nierenhitze.
Im Mittelalter vertiefen die arabischen Ärzte die antiken theoretischen und therapeutischen Kenntnisse.
So veröffentlichte der arabische Universalgelehrte Abd al-Latif al-Baghdadi (1163-1231) im Jahr 1225 ein ganzes Traktat über Diabetes.
Dagegen geht das lateinische Mittelalter kaum auf die Erkrankung ein.
Mit Ausnahme von Paracelsus (1493-1541; schweizerisch-österreichischer Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker und Philosoph – Theophrastus Bombast von Hohenheim, fälschlich auch Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim genannt, seit 1529 sich Paracelsus nennend), der die traditionelle Verknüpfung des Diabetes mit Nieren und Magen aufgibt.
Er bringt biochemische Prinzipien ins Spiel und hält Diabetes für eine entgleiste Verbindung von Sulphur/Sulfur (Schwefel) und Salzen im Blut. Diese würden in die Nieren übergehen, diese erhitzen und starke Urinausscheidungen hervorrufen.
Sprung ‚zurück‘:
Schon in der Antike litten die Menschen an und unter Diabetes.
Nur wusste damals niemand, woher die Krankheit kam und wie man sie behandeln konnte. Jahrtausende lang siechten die Kranken dahin, bis sie völlig abgemagert starben.
Der Begriff Diabetes mellitus leitet sich vom griech. Diabainein (= hindurchfließen) und dem lat. mellitus (= honigsüß) ab.
Das Krankheitsbild wurde erstmals vor etwa 3500 Jahren in Ägypten beschrieben.
In der Schweiz definiert Johann Conrad Brunner (1653-1727 – Schweizer Arzt, Anatom und Physiologe) die Zusammenhänge von Diabetes und Bauchspeicheldrüse.
Im Jahre 1889 fanden Freiherr Josef von Mering (1840-1908 / deutscher Internist und Pharmakologe; er forschte auf den Gebieten Physiologie und Pharmakologie) und Oskar Minkowski (1858-1931 / litauisch-deutscher Internist) heraus, dass es sich beim DM definitiv um eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse handelt.
Beide experimentierten nit Fettstoffwechselstörungen und entfernten dazu einem Hund die Pankreas vollständig.
Die Folgen blieben nicht aus:
Das Tier zeigte zunächst alle Anzeichen eines Diabetes wie übermäßigen Durst, große Harnmengen, Abmagerung trotz reichlicher Nahrungszufuhr und es verstarb dann recht bald.
Anders als Johann Conrad Brunner untersuchte er den Urin des Tieres auf Glucose und kann so den Nachweis eines Diabetes mellitus führen.
Fakt:
Die Bauchspeicheldrüse gilt wieder als lebenswichtiges Organ, Mering + Minkowski nennen die Erkrankung „Pankreas-Diabetes" und auf diesem Boden können später weitere Forschungen zur inneren Sekretion der Hormone geführt werden.
Die beiden stellen dabei unter anderem auch das Auftreten von Aceton im Harn heraus, die Acetounurie.
Minkowski beginnt dann auch, diese neuen Erkenntnisse praktisch anzuwenden.
Er stellte nämlich fest, dass die diabetischen Symptome ausbleiben, wenn man den Versuchstieren Teile der entfernten Pankreas unter die Haut verpflanzt.
„Das war der eigentliche Beginn einer Organ-Therapie!“
Das Wettrennen um einen wirksamen Pankreas-Organ-Extrakt hat begonnen.
Also injiziert er den Hunden Extrakte aus „Pankreas-Saft", was aber zunächst nur zu Gewebsuntergängen führt.
Es dauerte dann weitere 32 Jahre, bis 1921 Sir Frederick Grant Banting (1891-1941 / kanadischer Chirurg und Physiologe), John James Richard MacLeod (1891-1041 / schottisch-kanadischer Physiologe) und Charles Herbert Best (1899-1978 / US-amerikan.-kanadischer Physoiologe und Biochemiker) die Blutzucker-senkende Substanz der Pankreas, das
Insulin, entdeckten.
Vor dem ersten Einsatz dieses Peptid-Hormons () im Jahre 1922 führte ein Insulinmangel-Diabetes unweigerlich zum Tode!
Etwa zeitgleich wurden die ersten Medikamente mit blutzucker-senkenden Eigenschaften identifiziert.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der oralen Antidiabetika (OAD) sowie der Insulin-Therapie bis zur heutigen Zeit führte schließlich dazu, dass die Lebensqualität der Patienten gestiegen ist und die Entstehung der diabetischen Folge-Erkrankungen verhindert bzw. verlangsamt werden kann.
Übrigens:
In der Antike wurde die Diagnose „Diabetes mellitus“ durch eine Geschmacksprobe des Urins gestellt, denn der Harn von Personen mit Diabetes weist bei erhöhtem Zuckerspiegel infolge der Zucker-Ausscheidung im Urin einen durch den Zucker süßlichen Geschmack auf.
Nun zur Historie der Krankheit in chronologischer Abfolge.
Zu beginnen ist bereits in der „Antike“:
Schon um 100 n. Chr. schreibt Aretaios von Kappadozien (80-138 n.Chr. / er war ein griech. Arzt / er lebte in Kappadozien/ Kleinasien und Ägypten; er schrieb ein 2-bändiges heilkundliches Kompendium und ein 8-bändiges Lehrbuch über chronische Krankheiten, darunter Diabetes mellitus und Epilepsie):
„Der Diabetes ist eine rätselhafte Erkrankung“.
Er beschreibt die Symptome und den Verlauf:
Diabetes ist ein furchtbares Leiden, nicht sehr häufig beim Menschen, ein Schmelzen des Fleisches und der Glieder zu Harn... Das Leben ist kurz, unangenehm und schmerzvoll, der Durst unstillbar, ... und der Tod unausweichlich“.
Die Hl. Hildegard von Bingen (1098-1179 – Benediktinerin, Äbtissin und vor allen Dingen eine hochgeachtete „Universalgelehrte“ und Kräuter- und Pflanzenkundige – sie ist Gründerin der nach ihr benannten ‚Hildegard-Heilkunde‘) empfahl zur Behandlung des Diabetes die Einnahme des Bertram-Wurzel-Pulvers (Radix Pyrethri einem Ableger der Anacyclus pyrethrum (Bertram-Wurzel auch genannt ‚Deutscher Bertram‘).
Dann ein gewaltiger Sprung ins 17. Jahrhundert:
Hier beschreibt Thomas Willis (1621-1675 / er war ein engl. Arzt und gilt als „Begründer der Anatomie“ – er entdeckte den Arterienring im Gehirn, den „Circulus arteriosus Willisii“ und er führte die noch heute gültige Nummerierung der Hirnnerven ein!):
Er beschrieb den „honig-süßen“ Geschmack des Urins bei Diabetikern.
Willis beschrieb auch die Symptome der diabetischen Neuropathie bei seinen Patienten.
Heilen konnte er den Diabetes nicht:
Er beobachtete zwar, dass es Patienten unter einer extrem hypokalorischen (= deutlich bzgl. der Energie-Zufuhr verminderten) Diät vorübergehend besser ging; er kannte aber die Zusammenhänge noch nicht. Im Gegensatz zu seiner Kollegenschaft, die den Diabetes als reine Nierenkrankheit ansahen, vermutete er jedoch bereits, dass die Ursache im Blut liegen müsse.
1683 entfernte Johann Konrad Brunner (1653-1727 – Leibarzt des Kurfürsten von der Pfalz, von diesem in den Adelsstand erhoben als „Brunn von Hammerstein“) Hunden die Bauchspeicheldrüse und beobachtete als Folge extremen Durst und Polyurie; er gilt somit als Entdecker des pankreopriven Diabetes mellitus.
Weiter ins 18. Jahrhundert:
Matthew Dobson (1745-1784 – engl. Arzt und experimenteller Physiologe) experimentierte mit dem Urin von Diabetikern. Durch Verdampfung trennte er die flüssigen von den festen Bestandteilen. Übrig bleibt laut Dobson eine weiße Masse …
Читать дальше