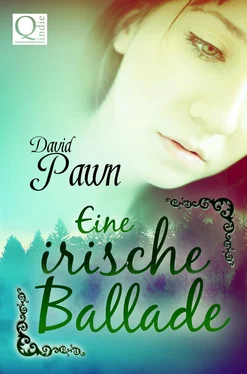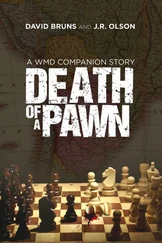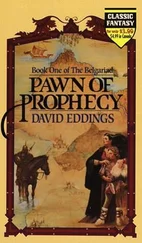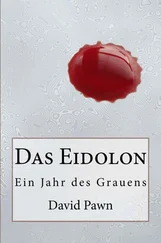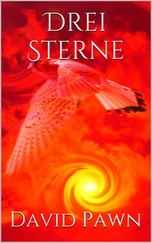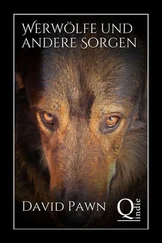Daniel war immer lauter geworden bei den letzten Sätzen. Ich sah eine Frau, die sich zu unserem Tisch umblickte, aber das war mir egal. Ich brach in Tränen aus.
„Aber … das ist … die Wahrheit“, schluchzte ich. „Ich bin eine irische Banshee. Ich habe nahezu 600 Jahre lang der Familie Carr gedient. Als ich dich kennengelernt habe, ist ein Teil des Fluches von mir genommen worden. Darum konntest du … konnten wir …“ Ich stotterte herum und hob in einer hilflosen Geste die Hände.
„Nein! Nein, das kann ich nicht glauben. Ich glaube ja nicht einmal an Gott, wie soll ich da irgendwelche alten Legenden für wahr halten. Was tischst du mir als Nächstes auf? Kobolde?“
Ich verkniff mir die Bemerkung, dass Kobolde durchaus real seien. Es würde einige Zeit dauern, bis ich Daniel über alles berichten konnte, was ich gesehen und erlebt hatte. Vielleicht würde ich ihm auch nie wieder etwas erzählen.
Er atmete tief durch. „Ich muss nachdenken“, sagte er. „Über dich, über uns. Bitte geh.“
Wie versteinert blieb ich trotz seiner Worte sitzen. Ich sah ihn nur mit großen Augen an. Das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich hörte das Klappern von Tellern und Besteck. Ich war für einen Moment wie aus der Wirklichkeit gefallen.
„Aber …“ Ich wollte etwas sagen und wusste nicht was. Das war das Ende. Daniel wollte einen Schlussstrich ziehen.
„Bitte, Síochána, wenn dir etwas an mir liegt, an uns liegt, dann geh jetzt. Ich melde mich bei dir, wenn ich weiß, ob …“ Jetzt wusste auch er nicht mehr weiter. Ich sah Tränen in seine Augen treten. „Wenn ich mir sicher bin, melde ich mich bei dir“, sagte er.
‚Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an.‘ Die allgemein übliche Formel, wenn man abgewiesen wurde.
Ganz langsam erhob ich mich von meinem Platz. Ich blickte auf Daniel hinunter, der mit ineinander verkrampften Fingern dasaß. Er sah nicht zu mir auf.
„Ich rufe dich an“, sagte er noch einmal leise. „Bald.“
In den nächsten beiden Tagen saß ich in meinem Hotelzimmer und starrte mein Handy an. Wider jede Vernunft hoffte ich doch auf einen Anruf von Daniel, hoffte seine Stimme etwas sagen zu hören, was die vergangenen achtundvierzig Stunden tilgen würde.
Als dieser Anruf schließlich tatsächlich kam, hätte ich ihn beinahe verpasst, weil ich meinen Kummer an die Hotelbar getragen und in irischem Whisky ertränkt hatte. Ich war gerade mit schwerem Schritt wieder in mein Zimmer gekommen, als das Telefon klingelte. Dessen Bedienung war meinem benebelten Hirn ein nahezu unlösbares Rätsel. ‚Daniel‘ prangte auf dem Display, aber das war gar nicht nötig, denn ich erkannte den besonderen Klingelton. Panisch fummelte ich an dem Gerät herum, immer wieder das Mantra aller einen Anruf erwartenden, dann in Panik verfallenden Menschen vor mich hin murmelnd: „Leg nicht auf. Leg nicht auf.“
Schließlich schaffte ich es doch.
„Hallo!“
„Síochána?“
Wer sonst sollte an mein Telefon gehen? „Ja.“ Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Liebst du mich noch? Kommst du zurück? Bleibst du bei mir? Alle diese Fragen blieben ungestellt.
„Können wir uns treffen?“
„Gern. Wann? Wo?“ Ich war schlagartig beinahe wieder nüchtern. Jedenfalls glaubte ich das in diesem Moment.
„Jetzt. Ich stehe vor dem Hotel. Wir könnten einen kleinen Spaziergang machen.“
„Ich komme sofort.“ Ich war schon unterwegs, während ich diesen kurzen Satz sagte.
Der Fahrstuhl wollte nicht kommen, also nahm ich die Treppe und wäre beinahe hinuntergefallen. Mein Kopf schien zwar einigermaßen klar, aber die Motorik war noch immer gestört.
Daniel stand im Foyer, blickte zum Fahrstuhl und rang die Hände. Er sah mich nicht, da ich einen anderen Weg genommen hatte. Mein erster Gedanke war, ihm von hinten um den Hals zu fallen, aber es meldeten sich rechtzeitig ein paar vernünftige Hirnzellen zu Wort, die das zu einer schlechten Idee erklärten. Also tippte ich ihm nur auf die Schulter.
„Hallo Daniel“, sagte ich zaghaft.
Er drehte sich um, sah mir in die Augen und sagte: „Hallo Síochána! Können wir gehen.“
Ich nickte heftig. Es war eine dieser überzogenen Gesten, die Betrunkene machen, wenn sie sich um Kontrolle bemühen.
Daniel bemerkte meinen Zustand offenbar nicht, er machte sich auf den Weg nach draußen und ich folgte ihm. Erst als ich auf dem Weg erneut ins Stolpern geriet und mich an ihm festklammerte, fiel ihm auf, dass etwas nicht stimmte. Er blieb stehen, sah mich an und fragte: „Was hast du?“
„Nichts.“ Ich schüttelte vehement den Kopf, meine Haare strichen ihm durchs Gesicht. Mit diesem Wort flog offenbar auch eine Wolke Whiskydunst zu ihm hinüber und strafte mich Lügen.
„Du hast getrunken. Síochána! So kenne ich dich gar nicht.“
„Ich war auch noch nie so verzweifelt“, erwiderte ich.
„Komm, gehen wir an die frische Luft. Halt dich bei mir fest.“ Ich hakte mich bei ihm ein und wir gingen nach draußen.
Wie bekannt, ist frische Luft bei einem leichten Rausch eher ein Mittel, diesen kurzfristig zu verstärken oder massiver in seinen Auswirkungen sein zu lassen. Ich weiß nicht, was aus medizinischer Sicht hier korrekt ist. Und als ich mit Daniel nach draußen trat, wusste ich kaum noch, an wessen Arm ich da hing. Ich zerrte ihn nach rechts und links, und wir bewegten uns in sanften Kurven bis zur Oos und an dieser entlang zur Gönneranlage. Was mochten nur die Kurgäste von meinem Begleiter halten, der da eine sichtlich angetrunkene Person abschleppte.
„Síochána, bitte“, sagte er. „Wir müssen wie erwachsene Menschen miteinander reden. Ich konnte zwei Tage lang kaum schlafen. Immer wieder habe ich dein Gesicht vor mir gesehen und mich gefragt, wie es weitergehen soll.“
„Ich habe dich so vermisst“, gurrte ich und sah ihn schmachtend an. Der Whisky und ich waren einer Meinung.
Wir erreichten eine Bank.
„Komm, setz dich.“ Daniel hatte sich bereits niedergelassen und klopfte auf das Holz zu seiner Rechten. Ich versuchte, mich auf seinen Schoß zu setzen, aber er schob mich sanft zur Seite, so dass ich an seinem Schenkel abglitt und auf der Bank zu sitzen kam.
„Versuch vernünftig zu sein, bitte.“ Daniel sah mich mit traurigen Augen an.
Ich konnte nicht anders. Ich warf beide Arme um seinen Hals, drückte ihm jeweils einen Schmatz links und rechts auf die Wange und sagte: „Du bist zurückgekommen. Du bist zu mir zurückgekommen.“
Erst schien mir, als wollte er sich aus der Umarmung befreien, aber er ließ mich doch gewähren. So saßen wir eine ganze Weile in der wärmenden Sonne – er gerade wie ein Stock und ich an seinem Hals hängend. Dann spürte ich plötzlich seine Hände auf meinem Rücken, die mich streichelten.
„Wenn ich ehrlich bin“, hörte ich ihn sagen, „hätte ich es auch nicht mehr länger ohne dich ausgehalten. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum du mir diese Banshee-Geschichte aufgetischt hast. Ich habe keine vernünftige Erklärung gefunden.“
„Es gibt einen ziemlich einfachen Grund“, sagte ich mit schwerer Zunge. „Es ist die Wahrheit.“
„Aber das ist doch verrückt. Sieh mich an.“
Ich gehorchte, nahm meinen Kopf von seiner Schulter, wo er gerade geruht hatte, und blickte ihm in die Augen. Alles drehte sich. Trotzdem versuchte ich, seinen Blick so fest und geradlinig zu erwidern wie möglich. Einmal mehr sah ich Williams Augen vor mir, seinen verzweifelten Ausdruck, als ich seine Werbung ausgeschlagen hatte. Obwohl dieser junge Mann aus Baden keine Beziehung zu den Carrs haben konnte, so musste er doch auf irgendeine Weise etwas mit William gemein haben, das weit über die Augen hinausging. Man sagt, die Augen seien das Fenster zur Seele. War es das? Waren sie seelenverwandt?
Читать дальше