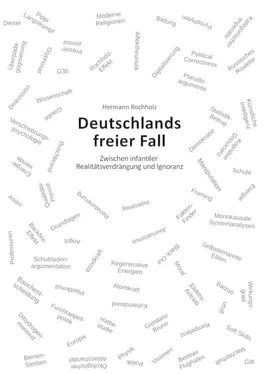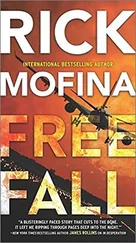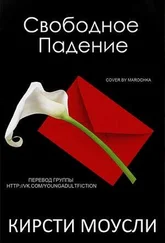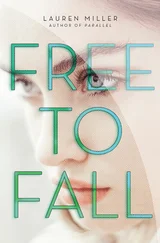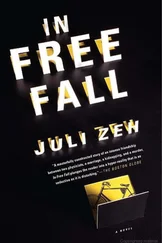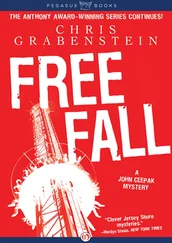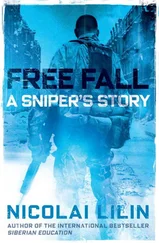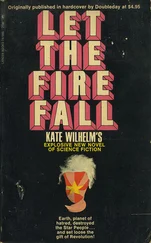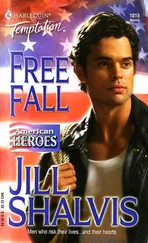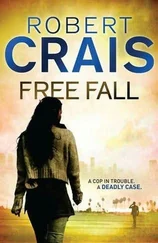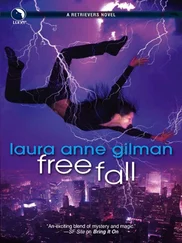Viele Dinge muss man (leider) „nur“ wissen. Wenn man aber etwas wissen müsste, kann man nicht wissen, dass man es wissen müsste: Wenn man beispielsweise nicht weiß, dass es „Pyrophyten“ gibt und dass diese in Australien besonders häufig sind, kann man nicht auf die Idee kommen, sich über diese auf dem Internet zu informieren. Dazu später mehr.
Wenn jemand versucht, Knieschoner aus einem kohlefaserverstärkten Kunststoff herzustellen, muss man wissen, dass dieser Werkstoff „schlagempfindlich“ ist. Auch muss man wissen, dass das Argument, Kohlefasern seien „stabil“, ein Unsinnsargument ist, denn in der Technik ist das Umgangsdeutsch-Wort „stabil“ unbekannt. Es gibt zugfest, druckfest, schlagzäh,... - aber „stabil“ nicht. Argumentiert jemand damit, kann man schließen, dass die Person von Technik ahnungslos ist.
In „innovative“ Fluggeräte werden Millionen investiert: Triebwerke von Verkehrsflugzeugen wurden immer größer. Der „Vortriebswirkungsgrad“ macht die Sache noch schlimmer. Das müssen Sie nicht verstehen, denn dafür muss man das Fach studiert haben. Einfacher: Alle, Boeing und Airbus, verbauen über Jahrzehnte immer größere Triebwerke. Dann kommt einer, der Minitriebwerke verwendet und diese elektrisch antreiben will. Ist da jemand schlauer als die gesamte restliche Welt?
Aussagen von Personen muss man im Zusammenhang sehen: Ein Politiker erklärt „unter Freunden spioniert man nicht“ bei Spionagevorwürfen gegen die NSA. Man muss wissen: 23 Jahre vorher hatte Frankreich über eine neue (französische) Telefonanlage alle Telefongespräche der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes mitgeschnitten (mit einem sogenannten „Backdoor“). Helmut Kohl rastete im Meeting aus. Konsequenz ist, dass Aussagen wie „wir schaffen das“ zur Bauchschmerzaktion werden. Denn man will offensichtlich Probleme nur aussitzen und nie an der Wurzel angehen.
Bisweilen reicht ein Vergleich aus: Wenn zwei Dinge gleich aussehen müssen, es aber nicht tun, muss ein Fehler vorliegen.
Heutzutage werden Bewertungen dadurch erschwert, indem alles international ist. Eine der schwierigsten Fragen ist diesbezüglich, wie sinnvoll es ist, etwas zu tun, wenn es alle Nachbarn nicht tun.
Ein Hinweis auf die Gültigkeit von Argumenten gibt auch, wenn man überprüft, wie Dinge früher gehandhabt wurden und warum dies damals so gemacht wurde. Rudolf Steiner, Gründer der Waldorfschulen, war konsequent gegen das Spritzen von Giften. Zu seiner Zeit existierten keine selektiven Gifte. Man benutzte Schwermetalle, mit denen man Böden verseucht, da sie grundsätzlich nicht chemisch abgebaut werden können. Gleichzeitig enthielt Gemüse selbst viel mehr Fraßgifte (vgl. Ref. 37), die schon lange herausgezüchtet sind. Somit hatte er vor 100 Jahren Recht, wenn er den Einsatz von Spritzgiften ablehnte. Die Frage ist, inwieweit dies auf die heutige Zeit übertragbar ist.
Man benötigt also einen neutralen Vergleich, um zu bewerten,
ob und wie der Fortschritt oder auch Rückschritt aussieht.
Ähnlich verhält es sich mit technischen Systemen: Ein Wasserstoffauto ist gut, wenn flüssiger Wasserstoff vorhanden ist. Wasserstoffantrieb wurde vor 35 Jahren propagiert. Zu dieser Zeit schien durch Atomkraft Energie unbegrenzt verfügbar. Die Zeiten haben sich aber geändert. Japan geht den Weg mit Atomkraft und fördert deshalb den Elektroantrieb.
Elektroautos sind ein wunderbares Fortbewegungsmittel in Schweden und Norwegen. Dort fahren sie fast CO2-frei. Denn dort gibt es reichlich Atom- und Wasserkraft. Nun stellt sich die Frage, ob sich diese Bedingungen auch auf Deutschland übertragen lassen.
Last but not least sollte man prüfen, mit welchem Realitätssinn Menschen ihre Aufgaben bewältigen: Jemand, der weder Fregatten zum schwimmen, Flugzeuge zum Fliegen noch Gewehre zum Schießen bringt, ist sicherlich nicht geeignet, zukünftige Herausforderungen zu bewältigen.
Meinungsfreiheit ist Grundrecht in einer Demokratie. Man kann also der Meinung sein, dass, wenn man zwei Bier trank und dann noch einmal zwei Bier trinkt, es in Summe drei Bier sind. Somit haben Meinungen mit Fakten nichts zu tun. Trotzdem wird bei technischen Dingen häufig argumentiert: „Das ist deine Meinung, ich habe ein andere!“. Das ist eine Begriffsverwirrung: Meist ist es die Physik: Wenn man mit dieser (meist mit Hilfe der Mathematik) darlegen kann, dass etwas nicht funktioniert, kann man noch so viele Meinungen haben: Sie sind irrelevant.
Deutschland gilt als „Hochtechnologieland“. Jeder Mensch hat eine eigene Sicht der Dinge, auch der Autor, denn er ist Ingenieur und jeder Beruf hat eine spezifische Sichtweise. Wenn ein Nicht-Ingenieur über eine Pressemitteilung „stolpert“, in der berichtet wird, dass etwas nicht funktionierte oder der Zeitplan 13 Jahre hinterherhinkt, so nimmt er es hin. Insbesondere kann er oder sie es nicht bewerten – wie auch?
Dann gibt es Leute, die wissen wollen, was zum Scheitern oder zur Kostenexplosion beigetragen hat. Denn Fehler haben normalerweise den Vorteil, dass man aus ihnen lernen kann. Sowohl die eigenen als auch die anderer Leute. Nichts ist dümmer, als einen Fehler zu wiederholen. Leider kann man heutzutage meist nichts lernen, denn es wurde im Studium gelehrt, wie man es korrekt gemacht hätte. Oder man lernte es im Beruf. Festzustellen ist: Überall wird Hightech herausgekehrt, aber gravierende Fehler in den Grundlagen gemacht. Dies ist bedenklich, denn Grundlagenfehler sind vor Allem eins: extrem teuer.
Das rächte sich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber: In verschiedensten Bereichen hörte man nur von Millionenverlusten. Für Werbung wurde viel Geld ausgegeben. In oberen Positionen waren Personen involviert, die fachlich durch Inkompetenz glänzten und auf Rattenfänger hereinfielen, die ihnen ihre Visionen verkauften. Es wurden Parolen herausgegeben, wie toll es der Firma geht und wie toll die Produkte sind. Kritiker wurden kaltgestellt. „Wir haben den bayrischen Staat als Bürgen – uns kann nichts passieren!“ wurde erklärt. Nachträglich scheiterte die Firma an der Summe aller Kleinigkeiten. Wenige Tage vor der Insolvenz wollte man 0,8 mm Stahlblech auf die Tragflächen nieten, da deren Torsionssteifigkeit 2nicht ausreichte. Die Probleme kannte man lange vorher, aber sie wurden jahrelang unter den Teppich gekehrt und keines an der Wurzel gelöst. Man „bastelte“ nur an den Symptomen herum. Zuletzt kam dann alles zusammen.
Die Politik Deutschlands ist nichts anderes als ein „Flashback“.
„Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ – so der Konsens vieler Leute, die keine gute Meinung von Statistik haben. Dies ist auch deshalb nicht verwunderlich, da Statistik ein Teil der Mathematik ist und sie ist nicht beliebt. Was man nicht versteht, lehnt man eher ab, was ein menschlicher Zug ist. Gleichzeitig sucht man Argumente für diese Einstellung, um die persönlichen Vorurteile zu bestätigen. Auch das ist menschlich, aber nicht zielführend.
Was aber nicht sinnvoll ist, denn Statistik schafft Fakten, mit denen man Beweise führen kann. Vielmehr ist man in unserer Gesellschaft bei jedem Gebrauchsgegenstand mit Statistik umgeben, denn sie sind aus Materialien gebaut, für die es zur Feststellung der Materialeigenschaften Statistiken gibt.
Die Gültigkeit von DNA-Gutachten ist reine Statistik. Eine Übereinstimmung zweier DNA-Proben kann damit niemals 100 % ig sein, sondern liegt je nach Fall in der Größenordnung von 99,999995 %. Dies bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20 Millionen. Lehnt man statistische Beweise ab und „argumentiert“ polemisch, wie zu Beginn des Kapitels, ist man zwangsläufig dafür, DNA-Beweise abzuschaffen und insbesondere Sexualstraftäter freizulassen. Will das jemand wirklich?
Читать дальше