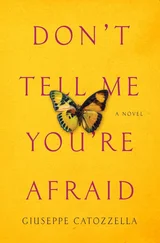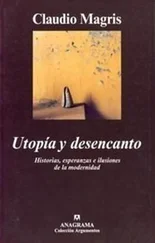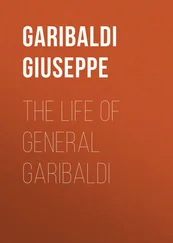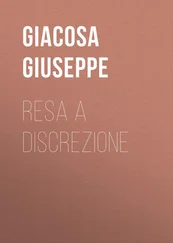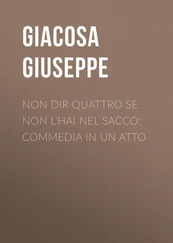Giuseppe Maruozzo
DESENCANTO
Die Entzauberung
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Giuseppe Maruozzo DESENCANTO Die Entzauberung Dieses ebook wurde erstellt bei
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Impressum neobooks
„Italiano?“
„Si, Italiano“, entgegnete er dem prüfenden, aber wohlwollenden Blick des jungen Zollbeamten, der in seinem sauber gebügeltem blauen Hemd eine überlegene Frische ausstrahlte, während ihn und alle anderen Passagiere die elf Stunden Flugzeit in eine unangenehme Rolle zwangen, die jeder Kontrolle anlastet, wenn sie in Form einer uniformierten Macht dem Kontrollierten Demut abverlangt.
Hinter jener Tür, die nur noch dieses junge schwarze karibische Gesicht versperren konnte, wartete das Land seiner Neugier. In seinem Blick muss wohl ein Hauch von Sympathie, die er diesem Land entgegenbrachte, spürbar gewesen sein, denn entgegen seiner Erwartung, streckte ihm der junge Polizeibeamte, ohne weiter in seinem Pass herumzublättern, diesen in die dafür vorgesehene Öffnung des Panzerglases und winkte ihn mit höflichem Tonfall weiter: „Puede passar senor.“
Er steckte seinen Pass eilig zu den anderen Reisepapieren, hob seine beigefarbene Ledertasche vom Boden und versuchte mit der linken Hand die Tür zu öffnen, was auf Anhieb misslang, denn man musste im engen Gang etwas zurückweichen und die Tür nach innen öffnen, sodass er gezwungen war, seine Tasche erneut abzustellen, zuerst seine Papiere, die er immer noch in der linken Hand hielt, in seiner Jackentasche verschwinden lassen, um dann einen neuen Versuch zu starten. Diese kleine Verzögerung hatte dem aufmerksamen Zöllner ein Schmunzeln entlockt, den wartenden Mitreisenden hingegen nur eine ungeduldige Gleichgültigkeit.
Hinter der Tür, in einem neondurchfluteten Raum, forderte das dunkle Gummifließband mit dem Passiertor daneben, stumm, aber ultimativ zur Gepäckskontrolle auf, bevor noch das Personal auch nur einen Ton hervorgebracht hatte. Wie ein Automatismus der Prozedur spielten sich die Gesten der Kontrolle in Jedem ab.
Er legte die Tasche brav aufs Band und die Augen der sitzenden Dame in der blauen Uniform begleiteten den Akt, während seine Hände schon in der Hosentasche bemüht waren, die Metallgegenstände auszusortieren.
Ohne Verzögerung passierte er den Kontrollrahmen, nahm die Tasche in Empfang, steckte den Geldbeutel und die Schlüssel wieder ein, ohne dass die Dame aufzustehen brauchte, sah sich nach der Gepäckausgabe um und war überrascht, wie modern die große Halle des Internationalen Flughafens von Havanna eingerichtet war.
Die Displays der Fluginformation strahlten den gleichen normierten Charakter eines elektronischen Zeitalters aus, wie überall sonst auf der Welt.
Um die geschlängelte Gepäckausgabe hatten sich die Passagiere des Flugs
de 6596 aus München gruppiert, die auf ihre Koffer warteten, darunter auch der Direktor des Goethe-Instituts, der sein Gepäck als einer der ersten erwischte und sich auch gleich davonmachte.
Nun schleppte auch er seinen Koffer und die beigefarbene Tasche weg aus der Halle nach draußen durch die Glastür, die die Sicht auf die wartenden Taxis nicht versperrte.
Zwei gelbe unscheinbare Fiat 125 wurden von Ankömmlingen bedrängt und bestiegen, sodass er nach weiteren Wagen Ausschau hielt. Er musste nicht lange warten, denn ein weißer Peugeot mit rotem „Taxi“-Schild auf dem Dach fuhr an ihn heran.
Der Fahrer, ein hagerer Herr mittleren Alters war ausgestiegen und hatte routinemäßig, aber ohne geschäftige Eile, den Kofferraum geöffnet und dem Fremden selbst das Hieven des Gepäckstücks durch dezente Zurückhaltung überlassen.
Aufgrund seiner rudimentären Spanischkenntnisse rief der Kubareisende dem Fahrer ein knappes „Hotel Habana Libre“ zu und stieg vorne ein.
Im Auto fiel ihm sofort das Taxameter auf, das ihn sehr stark an Taxifahrten in Rom erinnerte. Die gleiche eingebaute Metallhalterung und ein rechteckiger schwarzer Kasten mit Display und einem silbernen Drehknopf.
Mit Geldfragen wollte er sich aber jetzt nicht beschäftigen und streifte nur flüchtig die roten Zahlen des Displays während der Fahrt. Vielmehr war er gespannt auf die Menschen und die Stadt.
Es wehte ein sanfter Wind und tropisch heiß war es nicht, das enttäuschte ihn etwas, da er die Sonne liebte und Hitze eigentlich vermisste. Er schob es auf die Wolken und den Monat November. Er musste an Kolumbus denken, der am 28. Oktober des Jahres 1492 Kuba entdeckte und von der Insel schwärmte als das schönste Land, das die Augen eines Menschen je erblickten, und dann kamen ihm auch alle Daten des Reiseführers in den Sinn: Sie sei die größte der Westindischen Inseln mit einer Gesamtfläche von 114 524 Quadratkilometern, erstrecke sich lang und schmal von Westen bis zur östlichen Spitze bis über 1200 Kilometer, in der Breite zwischen 230 und 40 Kilometer schwankend. Dabei liege sie nur 34 Kilometer entfernt südlich von Key West, dem großen Bruder USA, genau südlich des nördlichen Wendekreises, aber das Klima sei eher semitropisch als tropisch.
Sie waren jetzt in einen Kreisverkehr eingebogen und er nahm die gemischte Bevölkerung noch intensiver war, Schwarze und braun gebrannte wechselten sich ab in einem farbigen Gemisch, indem bleiche Gesichter eher den Makel des Touristen verrieten, diesem Menschen, dem ein Webfehler anlastet, wie einem Lebensmittel sein Verfallsdatum.
Als sie aus einer Senke des Kreisverkehrs an einigen Motorrädern und offenen Lastkarren vorbei in die Avenida del Banco Boyeros bogen, stach ihm der Mythos direkt in die Augen.
Am Horizont sah er den Ché in seiner unverwechselbaren schwarz-weißen Silhouette mit dem Stern auf der Baskenmütze auf einer fabrikähnlichen Wand entgegenkommen, und als übergroße Gestalt von vielleicht 20 auf 10 Metern hinterließ er einen unauslöschlichen Eindruck, zumal dieser Eindruck noch mit dem Schriftzug „Patria y muerte“ den Betrachter als Mahnung erreichte.
Er bemerkte, dass sein Fahrer ihn flüchtig aus den Augenwinkeln beobachtet hatte, als er sich womöglich übertrieben gegen die Windschutzscheibe nach vorn gebeugt hatte, um den Mythos noch besser sehen zu können, und er glaubte sich einen Moment einfühlen zu können in den Schmerz dieses Daseins, in der die Geschichte einer Revolution die einen gegen die anderen aufgewühlt hatte und in einem Netz des Misstrauens zu ersticken drohte.
Damals, als die Guerilleros nach dem gescheiterten Überfall auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953 dezimiert in der Sierra Madre gegen die zahlenmäßig überlegene Armee Batistas ums Überleben kämpften, war der Spruch wohl noch eher eine Durchhalteparole gewesen, dachte er. Es war schwer, angesichts des weltweiten Zusammenbruchs des real existierenden Sozialismus dieser noch verbliebenen Trutzburg einer revolutionären Idee die Sympathie zu verweigern. Er tat es nicht und schwelgte noch in abstrakten Gedanken von Kontext und Denotation, als der Taxifahrer, der bisher stumm seiner Arbeit nachging, den Passagier zurückholte, indem er „Hotel Habana Libre?“ nachfragte.
Er schaute ihm etwas verblüfft in sein Latino-Gesicht mit den kleinen schwarzen listigen Augen, aber nach ein paar Sekunden fing er sich wieder mit einem höflichen „Si Senor, Habana Libre.“
Das Volk braucht mehr als Freiheit und Demokratie hatte der Comandante Barbudo in seinem Namen verkündet und es schoss ihm durch den Kopf, als er auf den Anhöhen Havannas das Meer hinter den Dächern der Stadt in der nun etwas stärker brennenden Mittagssonne einatmete und ihn die Gewissheit erklomm, nie fliehen zu müssen aus einem Paradies.
Читать дальше