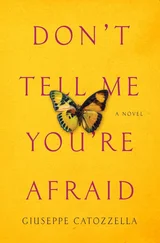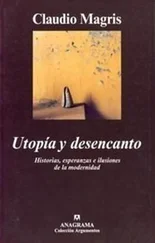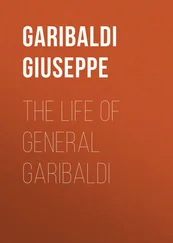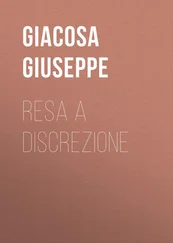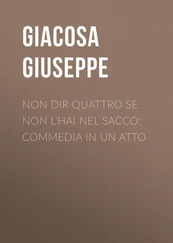Kubaner nennen jene Landsleute, die mit Booten und den Haien im Nacken ihrer Heimat den Rücken zukehren Gusanos , weil Sie ähnlich wie Raupen auf den Moment der Erlösung oder der Verdammung warten.
Wie Schmetterlinge kamen ihm jetzt die legendären Chevrolets und Cadillacs aus den Fünfziger Jahren vor, die immer zahlreicher wurden, je mehr sie sich durch die sanften abfallenden Straßen in Richtung Stadtzentrum bewegten.
Sein Fahrer war etwas gesprächiger geworden, vielleicht lag es auch daran, dass er einigen Freunden oder Bekannten begegnet war, denen er aus dem offenen Fenster nach draußen im Vorbeifahren unverständliche Worte lachend zugerufen hatte und die direkt neben einem schicken Polizisten mit Helm und Sonnenbrille und seiner Moto Guzzi standen. Danach wandte er sich an seinen Fahrgast und erklärte wie ein Cicerone , dass sie nun im Viertel Marti wären und nach dem angrenzenden Maceo gleich zum Palatino kommen würden.
„Palatino?“ fragte sein Fahrgast verdutzt, das war doch bekanntlich einer der sieben Hügel von Rom.
„Si, Senor, este Via Blanca a la derecha”, sagte der Fahrer zu seinem Fahrgast, während er gleichzeitig nach rechts deutete und fortfuhr ,“conduce en el Palatino.“
Sie fuhren aber weiter die Avenida de Rancho Boyero an einem großen Gebäude vorbei, von dem einige Krankenwagen herausfuhren und der Fahrer mit den Worten „Cristo Rey“ knapp kommentierte. Die Avenida verbog sich jetzt entlang der Plaza de la Revolucion zur Wegscheide und gab in der Mitte den monumentalen Helden seines Unabhängigkeitskampfes kolossal zur Bewunderung frei. Man hätte dieser Statue Josè Marti’s seine lebendigen Worte verleihen sollen, um die Tragik zu spüren, die so manchen Poeten befällt, wenn er sie denn hören könnte im Tumult der Gegenwart:
„ Der despotische Geist des Menschen verbindet sich in tödlicher Liebe mit dem Genuss, von oben herabzusehen und wie ein Herr zu befehlen, und sobald er diese Wonne einmal erfahren hat, scheint es ihm, als würde man seine Lebenswurzeln mit Stumpf und Stiel ausreißen, wenn man ihm dieses Vergnügen nimmt.“
Man begreift diesen epischen Zwist des kubanischen Volkes wohl nur, wenn man weiß, dass gerade sein legendäres Staatsoberhaupt in der Stunde der größten Gefahr für sein Leben Marti für sich sprechen ließ:
„ Der Strom der Tränen, die wir an den Gräbern unserer Toten vergießen können, ist begrenzt. Anstatt ihre Körper zu beweinen, sollten wir hingehen, um nachzudenken über ihre unendliche Liebe zu ihrem Land und dessen Größe, eine Liebe, die niemals wankt, die nie die Hoffnung verliert und niemals kraftlos wird. Die Gräber der Märtyrer sind unsere schönsten Altäre:
Wer stirbt
in den Armen des dankbaren Vaterlands,
für den hat der Tod seinen Schrecken verloren,
die Kerkermauern stürzen ein,
und am Ende beginnt mit dem Tode
das Leben.“
Martis Ahnung, dass die lange Ausübung der Macht die Sinne raube, war kaum mehr zu vernehmen, da ein Monument nur den Raum auszufüllen vermag.
Sie kamen in die Nähe der Universität und wurden von einer Gruppe von zahlreichen Schülern in ihren weiß-blauen Uniformen an einer Ampel aufgehalten. Er nutzte diese Verzögerung, um in seinem Reiseführer zu blättern, nahm einige Fotokopien der unzähligen Bücher heraus, die er über die Perle der Karibik gelesen hatte und stieß auf jene Seite, die die Ereignisse im Sommer 1952 betrafen und begann darin zu lesen:
Auf den 1. Juni 1952 war in Kuba eine Präsidentschaftswahl angesetzt worden. Eine Anfang März durchgeführte Meinungsumfrage hatte ergeben, dass von den drei Kandidaten Fulgencio Batista die geringsten Aussichten hatte. Zehn Tage später besetzte Batista um drei Uhr nachts das Camp Columbia, die größte militärische Festung des Landes, und übernahm das Oberkommando der Streitkräfte. Wenn er schon die Wahlen nicht gewinnen konnte, so konnte er doch wie im Jahre 1934 die Regierung mit Gewalt an sich reißen.
Wenige Wochen nach diesem Staatsstreich erschien ein junger, fünfundzwanzigjähriger Rechtsanwalt, der zwei Jahre zuvor auf der Universität von Havanna seinen Doktor gemacht hatte, vor dem dortigen Dringlichkeitsgericht. Er bewies in knappen Worten, dass Batista und seine Komplizen sechs Artikel des Strafgesetzbuches verletzt hatten, worauf ein Strafmaß von insgesamt 108 Jahren Gefängnis ausgesetzt war. Er forderte die Richter auf, ihre Pflicht zu tun:
„Nach allen Gesetzen der Logik muss Batista - wenn es noch Richter gibt auf Kuba - bestraft werden. Wird er aber nicht bestraft und bleibt weiter Staatsoberhaupt, Präsident, Ministerpräsident, oberster General, Chef des gesamten militärischen und des zivilen Bereichs, Gebieter über Leben und Eigentum, dann gibt es keine Richter mehr auf Kuba, dann wurden sie unterdrückt. Ist das die schreckliche Wahrheit?
Wenn sie es ist, dann sagen Sie es schnell, hängen Sie ihre Roben an den Nagel und geben Sie ihr Amt auf.“
Wer war dieser tollkühne Bürger Kubas, der ganz allein die Verwegenheit besaß, eine Armee von Halsabschneidern zu attackieren, die gerade zum zweiten Male die Macht im Staate erobert hatte? Was war das für ein Mann?
Er hieß Fidel Castro.
Die bunte uniformierte Schülerschaft hatte die Straße freigegeben und sie fuhren am Ort des damaligen Geschehens, der Universität, vorbei an einigen bröckelnden Häuserfassaden Havannas entlang in den Vorplatz des Hotels, das mit seinen 30 Stockwerken alle anderen Gebäude überragte, sich wie eine Leiter in den Himmel fraß und als „Emblematico & Unico“ sich auch auf den Prospekten der staatlichen Betreibergesellschaft präsentierte.
Vor dem Hotelkomplex fuhr eine Flotte von Taxen und Bussen vor und entlud seine Ladung einer gelockerten Einreisepolitik.
Auch sein Fahrer war die Calle L.Vedado entlang der Rampe in den weiträumigen Innenhof an parkenden Bussen direkt vor den Hoteleingang gefahren und wartete danach auf sein Geld am Steuer.
Er griff in seine Hosentasche, nahm zwei Dollar heraus, die er vorbeugend für diese Gelegenheit schon am Flughafen unbemerkt zurechtgelegt hatte, und übergab sie dem Fahrer mit einem „gracias Senor“. Wenn man bedenkt, dass ein Volksschullehrer auf der Insel circa dreitausend Pesos Jahreslohn bekommt, was ungefähr hundert Euro ausmacht, dann kann man sich anhand einer alltäglichen Dienstleistung und ökonomischen Beziehung, wie die zwischen einem europäischen Touristen und einem Taxifahrer, die gelockerte Einreisepolitik vereinfachend erklären.
Er war müde und jetzt umso dankbarer, als ein adrett gekleideter Hotelpage in Uniform seinen Koffer aus dem Taxi holte und ihn durch die vielen herumstehenden Gäste und Einheimische hindurchlotste, während sein Taxifahrer schon im Verkehr der Avenida 23 verschwunden war.
Der dunkelbraun gemusterte Granitboden glänzte elegant in einer riesigen Halle und reflektierte an Spiegelflächen auch das Licht eines gigantischen Kronleuchters, das wiederum den warmen Ton der Edelhölzer zurückwarf in das Purpurrot von Sofas und Sesseln einer privilegierten Schicht.
Sein Page hatte die zwei Stufen, die den langen Empfangstresen vom Eingangsbereich abhoben, ohne Mühe genommen und den Koffer an der Kristallfassade des Empfangs abgestellt und bezog selbst stumm und geduldig in der Nische einer Marmorsäule eine diskrete Wartehaltung, sodass der Kubareisende jetzt fast ausschließlich einer kreolischen Schönheit mit wundervoll langer schwarzer Lockenpracht nahe kam, die nicht nur einen Duftzauber versprühte, sondern auch durch die seidene Bluse und langen Ausschnitt einen Einblick in ihre reizvolle Weiblichkeit gewährte.
Er verspürte trotz seiner Müdigkeit einen sinnlichen Taumel, den er durch tiefes Einatmen noch verstärkte und durch Ihren Gruß in einen Bann geriet, den er mit einem Lächeln erwiderte.
Читать дальше