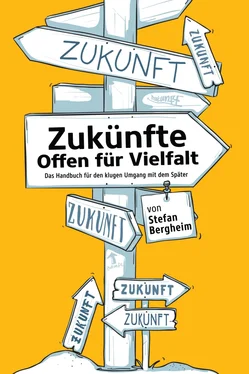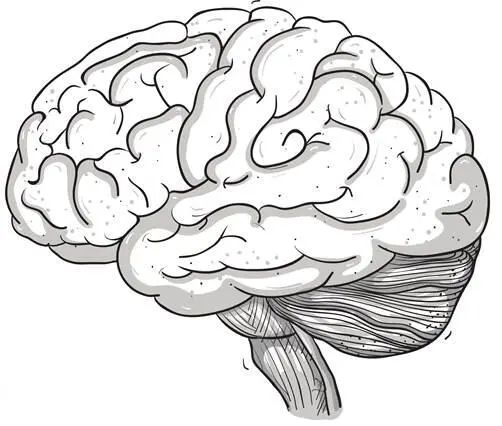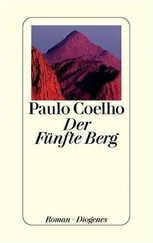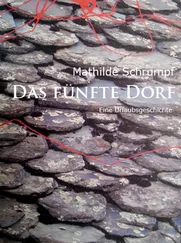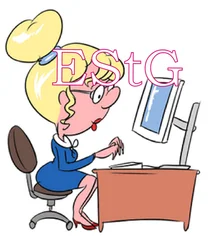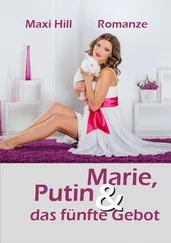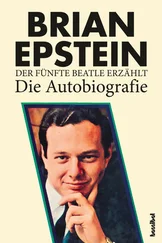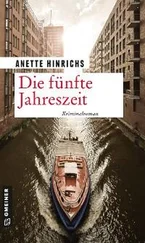2. Was macht für Sie eine hohe Lebensqualität in Frankfurt aus?
Mit dieser Frage sollte der Schritt vom Einzelnen hin zur Stadtgesellschaft gemacht werden. Das klappte recht gut, auch wenn die Antworten auf die erste Frage oftmals den inhaltlichen Rahmen für die Antworten auf die zweite Frage vorgaben. Hier war es in den Dialogveranstaltungen wichtig nachzufragen, die Teilnehmenden ins Gespräch miteinander zu bringen und aus den Verbindungen neue Ideen entstehen zu lassen.
3. Was tut Ihnen im Herzen weh, wenn Sie an Frankfurt denken?
Über diese Frage hatten wir im Projektteam lange und kontrovers diskutiert. Die Grundidee von „Schöne Aussichten“ war ja positiv zu arbeiten, wünschenswerte Zukünfte sichtbar zu machen. Und dann diese negative Frage. Im Rückblick war das die Frage, die besonders viele zusätzliche Themen sichtbar machte, ohne die Stimmung kippen zu lassen. Hier hatten alle eine Meinung und konnten konkretes Erleben mitteilen. Für die spätere Auswertung war die Frage unproblematisch. Es ging einfach darum, dass diese negativen Punkte weniger werden.
4. Frankfurt in 15 Jahren: welche Veränderungen wünschen Sie sich?
Hier sollte der Blick nach vorne gelenkt werden. Der Zeithorizont von 15 Jahren erschien uns überschaubar. Wirklich gut funktioniert hat diese Frage allerdings nicht. In den Antworten ging es vor allem darum, mehr von dem zu haben, was in Frage 2 diskutiert wurde und weniger von den Themen aus Frage 3.
Gute Fragen sind also ein essentieller Baustein für den gemeinsamen Umgang mit der offenen Zukunft in komplexen menschlichen Systemen. In den folgenden Kapiteln werden Fragen als ein roter Faden immer wieder auftauchen und konkrete Beispiele genannt.
Auch jedes Zukunftsprojekt, jede Initiative, jede Veranstaltung sollte für sich selbst bereits in der Entstehungsphase eine ganze Reihe von Fragen beantworten können. Der kanadische Prozessbegleiter Chris Corrigan hat sie in acht Stufen sortiert. Er beginnt mit dem Bedarf und fragt: Wie sieht das Umfeld des Projekts aus? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Welchen Bedarf soll das Projekt decken? Daraus sollte sich dann der Zweck des Projekts ergeben mit weiteren Fragen: Wenn das Projekt richtig gut läuft, was kann dann in unseren kühnsten Träumen entstehen? Was wollen wir anregen? Und: Was ist die einfachste und stärkste Frage, die den Kern unseres Projekts zum Ausdruck bringt? Ist das geklärt, dann geht es um ein gemeinsam entwickeltes und geteiltes Verständnis von den Prinzipien der Kooperation im Projekt: Wie wollen wir untereinander und mit den Teilnehmenden arbeiten? Woran sollten wir immer denken, wenn wir uns zur gemeinsamen Projektarbeit treffen?
Viertens geht es dann um die Menschen, die im Projekt dabei sind. Wer ist im Raum? Wer ist nicht im Raum und wie könnten wir sie hineinbringen? Wer hat ein Interesse an den Ergebnissen des Projekts? Erst dann geht es an die konkrete Konzeption und die vielen Möglichkeiten, die sich eröffnen: Welche Form soll unsere Arbeit haben? Welche Form passt zum Bedarf, zum Zweck, zu den Prinzipien und zu den Menschen?
Meine Lieblingsstufe in Corrigans Struktur ist die sechste, zu den einschränkenden Vorstellungen: Wovor haben wir Angst, wenn wir in diesem Projekt arbeiten? Welche alten Modelle und Strukturen wollen wir nicht beibehalten? Welche Fragen haben wir uns noch nicht gestellt? Dann geht es an die konkrete Struktur: Wie entscheiden wir worauf Zeit, Geld, Aufmerksamkeit und Energie gelenkt werden? Wieviel davon brauchen oder haben wir? Welche Rolle spielt das Kernteam? Anschließend geht es um die Praxis der Zusammenarbeit: Wer lädt zu Treffen ein? Welche Plattformen werden genutzt? Welche Netzwerke nutzen wir?
Und schließlich geht es um die Ernte: Wie soll das Ergebnis festgehalten werden? Wie kann die Ernte am besten dem Zweck des Projekts dienen? Wie bleiben wir offen für das, was dabei entstehen mag?
 |
Möglichkeiten für Sie rund um Fragen |
Das sind viele, viele Fragen. Es sind wichtige Fragen. Sie sind eine Einladung an Sie, Fragen stärker in den Blick zu nehmen. Dafür gibt es eine Menge von Möglichkeiten.
Darunter:
Wenn Sie an Veranstaltungen und Prozessen teilnehmen, so können Sie der jeweiligen Einstiegsfrage nachgehen und diese an den hier beschriebenen Kriterien spiegeln. Vielleicht haben Sie sogar vor oder während der Veranstaltung die Möglichkeit eine alternative Frage vorzuschlagen. Und Sie können überlegen, für wen diese Frage nicht relevant ist oder wer sie anders beantworten würde als die Menschen im Raum. Möglicherweise können Sie Impulse geben, um der Frage hinter der Frage nachzugehen. Als Organisatoren von Veranstaltungen und Prozessen können Sie die Einblicke dieses Kapitels nutzen, um die eigene Frage zu reflektieren und vielleicht noch kraftvollere Fragen zu formulieren. Und Sie können versuchen mehr von den Gruppen in den Raum zu bringen, die ebenfalls einen Bezug zu dieser Frage haben könnten.
Wenn Sie sich näher mit den genannten Quellen befassen mögen: Der erwähnte Artikel von Vogt, Brown und Isaacs aus dem Jahr 2003 trägt den Titel „The Art of Powerful Questions“ und ist im Internet leicht zu finden. Die vielen Fragen von Chris Corrigan stammen aus seinen „Chaordic Stepping Stones“, von denen es mittlerweile Varianten in verschiedenen Längen gibt.
Zum „Pro Action Café“ gibt es eine kurze englische Übersicht von Amanda Fenton. Zu Dynamic Facilitation ist englisches Material von Jim Rough verfügbar. Zudem gibt es einige Moderatoren und Autoren im deutschen Sprachraum.
3 Der Komplexität gerecht werden
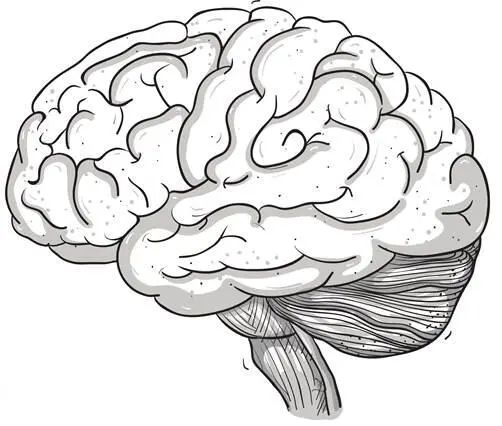
Frühjahr 2005 auf dem Campus der Katholischen Universität von Löwen. Ich warte in der Schlange auf den Bus, der die Teilnehmenden einer Zukunftsforscherkonferenz zum Abendessen ins historische Schloss Corroy bringen soll. Der freundliche Finne neben mir fragt mich, wie ich in meinen Prognosemodellen für die Deutsche Bank die Emergenz, die Nicht-Linearitäten und die finalen Ursachen komplexer Systeme berücksichtige. Vergeblich versuchte ich damals zu verstehen, was er mir sagen wollte und warum das für mich irgendeine Relevanz haben könnte. An diesem Abend begann meine wunderbar hilfreiche Lernreise in die Komplexitätstheorie und zu Methoden für mehr Lebensqualität, die der sozialen Komplexität so gut wie möglich gerecht werden. Der freundliche Finne war Mika Aaltonen, studierter Volkswirt und ehemaliger Fußballprofi. Er hat mich seither mit vielen anderen Menschen und Ideen aus der Welt der Komplexität verbunden, die für Zukünftearbeit wichtig sind.
Einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch
Meine Reise in die Welt der Komplexitätstheorie setzte sich auf Mikas Anraten fort mit der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen einfachen, komplizierten, komplexen und chaotischen Systemen. Ein System besteht aus mehreren Elementen, die in gewissen Beziehungen zueinander stehen. Der walisische Komplexitätsexperte David Snowden hat das in seinem Cynefin-Modell dargestellt. Er betont immer wieder, dass jedes dieser Systeme eine andere Vorgehensweise erfordert.
Einfache Systeme sind – einfach. Jeder versteht sie, es gibt eindeutige Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung. Eine Tür zu öffnen ist grundsätzlich für jeden Menschen möglich: Klinke runter, Tür bewegen, durchgehen. Viele Prozesse in der Wirtschaft wie Adressänderungen oder die Abfüllung von Flüssigkeiten gehören hier hinein. Für sie gibt es ein bestes Vorgehen („best practice“), klare zentrale Vorgaben und großes Potential für Automatisierung. Ganz ohne Gefahren sind diese Systeme allerdings nicht. Es kann sein, dass die Zentrale einer großen Organisation nur Vorgaben macht und zu wenig mitbekommt, was vor Ort geschieht. So kann sie schlecht auf Veränderungen des Umfelds reagieren. Es braucht einen Weg, auf dem neue, möglicherweise unangenehme, Informationen in die Zentrale gelangen können.
Читать дальше