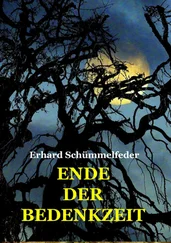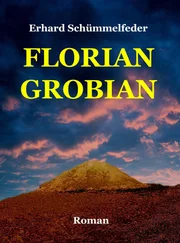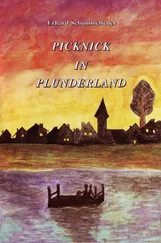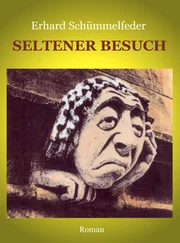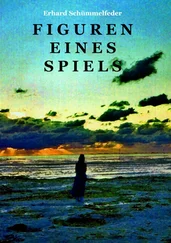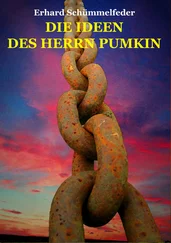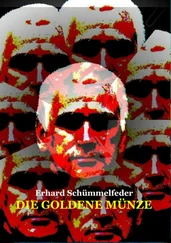Ich will nun ehrlich erklären, wie ich in die missliche Lage geriet, in der ich stecke. Möge jeder Leser dieser Zeilen sich ein gerechtes Urteil über mich bilden.
Heiligabend befand ich mich zu Fuß auf dem Heimweg und machte mir heftige Vorwürfe, weil ich das Weihnachtsfest mit meiner Frau nun vor dem Hintergrund unserer finanziellen Misere feiern müsste. Es war ein Fehler gewesen, im Pyrmonter Spielcasino unser gesamtes Vermögen in gewinnträchtiger Absicht einzusetzen. Alles, alles, was wir besessen hatten, war verloren. Ich hasste das Roulettespiel. Ich hasste die Farbe Rot. Ich hasste mich selbst. Ich hasste diese verfluchte Welt, die mich arglistig um unseren Besitz gebracht hatte.
Hätte ich nur auf meine Frau gehört, ging es mir durch den Kopf, während die ersten Schneeflocken vom Himmel schwebten. Hätte! Hätte! Hätte! - Hinterher ist man immer klüger als zuvor. Gut, ich hatte einen schweren Fehler begangen, als ich mich auf das teuflische Spiel einließ. Aber es war im Grunde nicht meine Schuld gewesen. Schuld waren andere Leute, gerissene Spitzbuben, die mich heimtückisch in diesen Sumpf gelockt hatten. Daran bestand für mich kein Zweifel. Meine Geduld mit den Speichelleckern, die sich durch mein Unglück bereicherten, war am Ende.
Mürrisch, reizbar, mit beiden Händen in den Manteltaschen, schlich ich durch das abendliche Pyrmont und suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Lauf der Dinge zu verändern.
Nicht einmal für eine Uhr, die Marie sich zu Weihnachten sehnlichst wünschte, besaß ich noch Geld. Wie würde sie über mich denken, wenn ich mit leeren Händen heimkehrte? Ich verdrängte den Gedanken.
Ich zitterte vor Kälte. Ich wusste mir keinen Rat, bis ich plötzlich in der sternengeschmückten Einkaufsstraße das hell beleuchtete Schaufenster eines Juwelierladens entdeckte. Zwischen tickenden Uhren und erlesenem Schmuck stand ein weißes Schild mit der Aufschrift
Ankauf von Münzen.
Inmitten der Menschenmenge, die mich umgab, erinnerte ich mich augenblicklich: In meiner rechten Manteltasche steckte noch die winzige Münze, die ich einige Tage zuvor auf dem Gehweg in der Geschäftsstraße gefunden und seither stillschweigend als mein Eigentum betrachtet hatte.
Die Münze war ein goldenes Zehnmarkstück, leicht in der Hand, beinahe unscheinbar, doch die eingravierte Jahreszahl, 1870 , ließ ein Gefühl der Hoffnung bei mir erwachen, und ich dachte immer wieder: Vielleicht ist sie noch was wert ...
Mit klopfendem Herzen, im vollen Bewusstsein der Erkenntnis, einen halben Fußbreit außerhalb der Legalität zu stehen, überschritt ich die Schwelle des Ladens. Ein weihnachtliches Glockenspiel über der gläsernen Tür erklang. Aus alter Gewohnheit bog ich - zu meiner eigenen Sicherheit - die Überwachungskamera in die Richtung der eichengetäfelten Decke. Ich war allein in dem Verkaufsraum. Nach einer kleinen Weile wurde der Vorhang eines Nebenzimmers beiseite geschoben und es erschien ein sehr seriöser älterer Herr, der mich mit gewinnender Höflichkeit begrüßte.
„Womit darf ich Ihnen dienen?“
Ich war noch etwas aufgeregt und beschloss, sogleich zum Kern der Sache vorzudringen, legte die Münze auf die Verkaufstheke und fragte eilig: „Wie viel?“
Der Juwelier - womöglich war es der Besitzer selber - nahm das Zehnmarkstück zwischen Daumen und Zeigefinger, wog es, betrachtete es skeptisch mit einer Lupe, die er einer verborgenen Schublade entnahm, und erklärte wie beiläufig: „Wir Münzsammler kennen bei der Bewertung von Münzen grundsätzlich vier Unterscheidungen -“ Nicht ohne Wohlwollen blickte er mich über den Rand seiner runden Brille hinweg an. Er fuhr fort: „Nämlich erstens schön, zweitens sehr schön , drittens vorzüglich und viertens vortrefflich .“
„Und wie würden Sie diese Münze bewerten?“, fragte ich bescheiden, wobei mir seine rote Fliege auffiel.
Er ließ sich Zeit mit seiner Antwort. „Nun“, meinte er desinteressiert, „ich würde sagen, diese Münze ist schön .“
„Warum nur schön ?“, wollte ich wissen und spürte, wie mein Blutdruck sich erhöhte.
Er zeigte auf die rechte Schwinge des Adlers auf der Vorderseite und hielt die Lupe darüber. „Sehen Sie diesen winzigen Kratzer oberhalb der Schwinge?“
Ich sah nichts. „Ja“, sagte ich unsicher und hoffte inständig, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Ich dachte auch an Marie und die Uhr, für die mir das Geld noch fehlte ... Jeder Preis, den er mir zahlen würde, sollte mir recht sein.
Er sagte: „Dieser Mangel, wenngleich er optisch eigentlich fast unerheblich ist, verringert den Wert des Objektes um mindestens einhundertzwanzig Euro.“
Die Art und Weise, in der er es sagte, klang einleuchtend und durchaus vernünftig. Ich nickte nur und dachte zähneknirschend: Schönschwätzergesülze.
„Den Wert - den jetzigen Wert der Münze würde ich auf etwa dreihundert Euro schätzen -“
„Dreihundert?“ Meine Augenbrauen hoben sich erwartungsvoll.
„Wenn - wenn Sie einverstanden sind, werde ich Ihnen für das seltene Stück dreißig Euro zahlen“, sagte er. „Sie müssen zugeben, dass das ein mehr als großzügiger Lohn ist.“
Wollte er mich für dumm verkaufen? „Lohn?“
„ Finderlohn“, sagte er milde lächelnd.
Diese höchst unpassende, ja sogar hämische Bemerkung ließ alle meine körperlichen, geistigen, emotionalen, sittlichen, kulturellen und humorgestählten Geduldsfäden gleichzeitig reißen. Ich war wie von Sinnen. Völlig unreflektiert und wild aufbrausend stürzte ich mich auf den verdutzten Mann und - und - und - ja, zum Teufel, ich erdrosselte ihn. Ich konnte es nicht verhindern. Es war nicht meine Schuld. Er hatte mich mit seinem altklugen Überlegenheitslächeln zu dieser Tat getrieben. Er trug die alleinige Verantwortung. Das hatte er nun davon!
Was als nächstes passierte?
Nun, ich öffnete die Ladenkasse und nahm mir aus den Geldfächern das heraus, was mir rechtlich zustand: Dreihundert Euro. Nicht mehr. Nicht weniger.
Gut, es kann sein, dass ich mich in der Aufregung ein wenig verzählte, da ich die Scheine in die Taschen meiner Hose und meines Mantels stopfte, während der Juwelier aufrecht, mit uneinsichtigem Verliererblick, an seinem Verkaufstisch lehnte. Seine besitzergreifenden Hände klammerten sich starr an den Rand der Glasplatte, unter der Uhren, Ringe und Ketten im Licht funkelten. Jeder, der einmal in eine ähnliche Situation geraten ist, kann bestätigen, wie leicht sich ein Zählirrtum einschleichen kann. Wer aber anderer Ansicht ist, sollte besser schweigen, denn im Zweifel wird immer noch zugunsten des Angeklagten entschieden. Das ist sogar gesetzlich verbrieft. Mehr sage ich dazu nicht.
Unterwegs in den Straßen Pyrmonts, unter all den Leuten, die ihre Weihnachtspakete nach Hause trugen, überlegte ich fieberhaft, ob es nicht besser gewesen wäre, die goldene Münze wieder an mich zu nehmen, denn meine Fingerabdrücke auf der Oberfläche könnten zu meiner Überführung beitragen. An das Gehäuse der Überwachungskamera dachte ich überhaupt nicht. Hätte ich doch nur die Münze in die Tasche gesteckt, ging es mir immer wieder durch den Sinn. Hätte! Hätte! Hätte! Hinterher ist man immer klüger als zuvor.
Ach, alles Klagen half nichts. Man würde mir früher oder später auf die Schliche kommen. Augenblicklich stand mein Entschluss fest: Ich wollte mich der Polizei stellen. Ein frühes Geständnis für eine Verzweifelungstat im Affekt, so überlegte ich, hat Aussicht auf Milde vor dem Gesetz.
Wenig später stapfte ich die Stufen zum Pyrmonter Polizeistation hinauf, öffnete die Eingangstür und begab mich an den Schreibtisch des diensthabenden Beamten in Uniform.
„Sie wünschen?“
Читать дальше