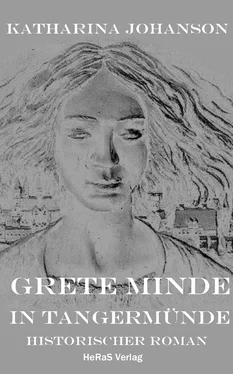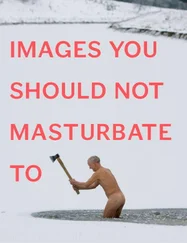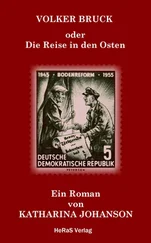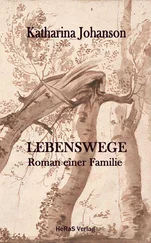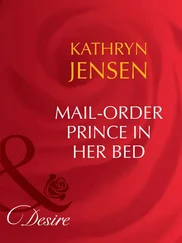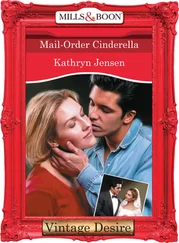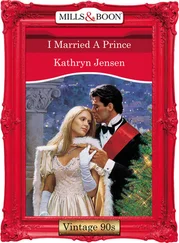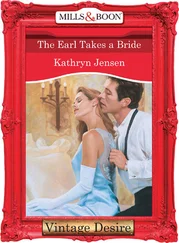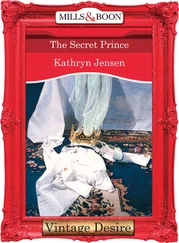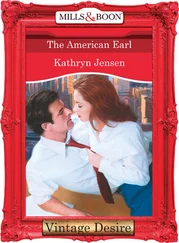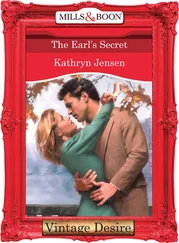Sie schleppten den Toten in die Sakristei. Margarete wusch den Verstorbenen und bahrte ihn in seinen besten Kleidern auf. Albrecht lud die Bodenbretter des Theaters vom Wagen ab, trug sie auf den freien Platz hinter der Basilika, richtete sich einen Arbeitsplatz ein und tischlerte einen Sarg zusammen. Er hob auch die Grube an vorbezeichneter Stelle auf dem Friedhof aus. Dann legten sie den Toten in den Sarg, umhüllten ihn mit weichen Tüchern, nagelten den Deckel fest, trugen den Toten im letzten Gehäuse hinaus und ließen ihn in das Erdloch hinunter. Ein paar Schaulustige waren auch zugegen. Priester Hagen kam in festlicher Kleidung und sprach ein Gebet. Sie sangen einen Choral. Das klang eher mäßig, weil außer Hagen kaum einer Text und Melodie draufhatte. Allein, es genügte dem guten Zweck. Schließlich schaufelte Albrecht das Grab zu und sie begaben sich in das Kirchlein.
Hagen sprach noch einmal ein Gebet für den teuren Toten und überließ dann die beiden Gotteskinder ihrer Trauer. Albrecht und Margarete knieten vor dem Altar und hielten stille Andacht. In der Sakristei holte der Priester das Kirchenbuch hervor und notierte: Christian Calberger, Schauspieler, 27. April 1610. Hinter die Eintragung malte er ein Kreuz und bezeichnete auch noch die Grabstelle auf dem Friedhof. Dann ging er seinen Alltagsgeschäften nach.
Irgendwann am Nachmittag dieses Tages hörte Priester Hagen Pferdegetrappel und den Wagen der Gaukler abziehen. Liederliches Volk, resümierte er, von Höflichkeit keine Spur! Man hätte sich verabschieden sollen, und der Obolus für die Beerdigung war auch nicht entrichtet. Leicht verstimmt trödelte er über sein Anwesen, schaute hier und da nach dem Rechten, setzte sich auf sein kleines Bänkchen vorm Haus, hielt Zwiesprache mit einer schwarzen Katze und döste in den Abend hinein. Als die Sonne dem Horizont schon sehr nahe war, erhob sich der Mann, um seine Kirche zuzusperren. Gewohnheitsmäßig, den Schlüssel schon im Schloss, lugte er in den sakralen Raum und sah zu seiner Verblüffung die beiden Gotteskinder unverändert vor dem Altar knien. Vorsichtig näherte er sich und fragte leise: „Was tut Ihr hier? Ich dachte, Ihr wäret fort.“ Margarete erhob sich und erklärte unbedarft: „Herr Priester, wir wollen noch heiraten. Ist das möglich? Heute noch oder morgen eventuell?“ Hagen sprach, Schlimmes ahnend, völlig entgeistert: „Euer Wagen ist fort!“
Margarete und Albrecht stürzten auf den Vorplatz und sahen, was sie nicht glauben wollten: Wagen und Pferd waren wie vom Erdboden verschluckt. Von Dieben fortgeschafft, von Müßiggängern geraubt, von Verbrechern gestohlen. Der gesamte Besitz ist verloren! Margarete stammelte fassungslos: „Unser Theater, unsere Bücher, unsere Kleider, unsere Betten, unsere Arzneien, unsere Lebensmittel, unsere Ersparnisse - alles weg.“ Es ist aus! Der Priester überschaute die Tragödie und fasste sich: „Kinder, ich denke, wir gehen erstmal zu mir rein. Essen und Schlafen könnt Ihr hier, fürs erste. Dann sehen wir weiter.“
Priester Hagen bemühte sich hingebungsvoll um die beiden mittellosen Schäfchen. Er gab ihnen zu essen und zu trinken, richtete ein Nachtlager her, spendete liebe Worte, traute sie am nächsten Tag zu Mann und Frau, hielt die Eheschließung der Margarete und des Albrecht von Minden in seinem Kirchenbuch fest und versuchte, den beiden nach besten Kräften neue Perspektiven zu eröffnen. Das war nicht ganz so einfach. Gern hätte er ihnen einen Teil ihres Eigentums ersetzt. Nur leider war er ja auch nur ein armer Mann. Er sparte nicht mit lieben Worten, den materiellen Verlust konnte er nicht ausgleichen.
Margarete und Albrecht erholten sich von ihrem Schrecken. Es musste ja irgendwie weiter gehen. Sie waren jung, sie rafften sich auf. Sie beschlossen, die Landstraße in altbewährter Form unter die Füße zu nehmen und sich Arbeit und Brot zu suchen. Schweren Herzens verabschiedeten sich die drei Menschen voneinander. Sich vor der Haustür noch eine Weile sprachlos, bedrückt, nachdenklich gegenüberstehend, fragte Albrecht endlich: „Was schulden wir Ihnen.“ Der Priester lächelte milde und wiegelte ab: „Nichts, meine Kinder.“ Da kramte Albrecht das Tuchpäckchen seiner Mutter hervor, knüpfte es auf, nahm einen Ring heraus und überreichte dem gütigen Gottesmann das Schmuckstück. Seiner verblüfften Frau und dem überraschten Priester erklärte er angeberisch: „Der kluge Mann baut vor. Eine kleine Reserve hat man doch immer.“ Befreit lachten alle drei. Margarete und Albrecht zogen von dannen. Hagen schaute ihnen noch lange nach, bis sie an einer Wegbiegung seinem Blick entschwanden.
Die kleine Reserve versetzte die beiden jungen Menschen in Hochstimmung. Ihre Pläne nahmen hoffnungsfrohe Formen an. Margarete betrachtete kennerisch das Goldkettchen mit dem Anhänger, der wie eine Krone geformt ist, und den Ring, und sie kalkulierte: „Für beides bekommen wir garantiert Pferd und Wagen, und wenn wir sehr gut handeln, sogar noch Wolldecken und etwas Kochgeschirr. Dann sind wir erstmal aus dem Gröbsten raus.“ Albrecht freute sich über die muntere Art seiner Frau. Allerdings gab er zu bedenken: „Das Kettchen dachte ich für Dich als Hochzeitsgeschenk, ist ja aus meiner Familie, und sollte sozusagen eine Tradition begründen. Den Ring können wir verkaufen. Sicher. Und was für Pferd und Wagen und Haushalt noch fehlt, muss ich eben erarbeiten.“ Gut gelaunt stimmte Margarete zu.
Margarete und Albrecht von Minden
Margarete und Albrecht von Minden durchwanderten kreuz und quer das Land. Der Geleitbrief über das Handwerk der Gaukler öffnete ihnen die Stadttore und stellte die patrouillierenden Landreiter zufrieden. Sie lebten von Gelegenheitsarbeiten in Haus und Hof. Zuweilen trat Margarete mit Gesang auf Märkten und in Gastwirtschaften auf. Allmählich kam wieder ein kleiner Hausstand zusammen. Nur leider niemals mehr so viel, dass man sich Pferd und Wagen hätte leisten können oder müssen. Sie transportierten ihr Eigentum auf dem Buckel und hofften von einer Station zur nächsten, dass es bald besser werden möge. Hin und wieder erwog Margarete das Goldkettchen, welches sie nun ständig um den Hals trug, zu verkaufen. Albrecht bestand darauf, die Kette zu behalten. Sie gab nach, und sie hungerten sich tapfer auch noch durch diese Krise. So vergingen viele Monate. Die Winter waren hart, die Quartiere eiskalt, des Sommers war die Landstraße staubig und trocken. Allein, die beiden verloren den Mut nie ganz und machten immer weiter.
Wie von einem Bannkreis umgeben mieden Margarete und Albrecht die Gegend um Tangermünde und Stendal. Man konnte nie wissen, inwieweit Albrecht noch gesucht wurde und eventuell erkannt werden würde. Obwohl Margarete nicht so recht glaubte, dass irgendjemand den Albrecht, so wie er heute ausschaute, überhaupt wiedererkennen könnte. Der Mann war in die Höhe und in die Breite gewachsen. Wetter, Arbeit, Erfolge und Misserfolge, Freud und Leid hatten ihn krass verändert. Aus dem ehemals zarten, gepflegten, verwöhnten und zuweilen unbeholfenen Knaben war ein äußerlich rein grober Kerl mit einem gewinnenden, freigiebigen Herzen geworden. Wiederzuerkennen war Albrecht bestenfalls an seiner Biografie und die musste er ja nicht jedem aufbinden. Nichtsdestotrotz schlugen die beiden um die Gegend von Tangermünde und Stendal gewissenhaft einen großen Bogen.
Im Herbst des Jahres 1613 kamen Margarete und Albrecht nach Wittenberge, eine Stadt an der Elbe. Sie hatten Glück. Der Schmied suchte gerade einen Knecht. Albrecht ward angenommen, Margarete verdingte sich als Magd im Haus, und sie bezogen ein Kämmerchen neben der Werkstatt. Das Stübchen war Tag und Nacht gut geheizt, denn das Schmiedefeuer loderte ohne Unterlass. Albrecht erhielt ausreichend Lohn, so dass sie nicht zu hungern brauchten. Wärme und Nahrung ließ die beiden aufleben und mit den Worten „hier bleiben wir endgültig“ setzten sich der Mann und die Frau in Wittenberge fest.
Читать дальше