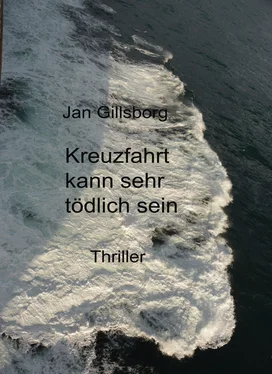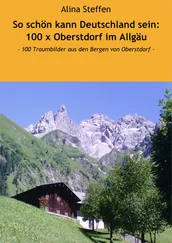„Um Gotteswillen! Nein! Da ist nichts. Wir lieben uns noch immer und wahrscheinlich noch viel mehr als früher. Paul ist in Polen. Dienstlich! Er berät Firmen, wie sie effektiver produzieren können und so weiter. Er kommt in zehn Tagen zurück und dann will er bei einer Kreuzfahrt mal vom Stress abschalten.“
„Ihr macht Urlaub auf See?“ Ich strahlte. „Da seid ihr nicht die Einzigen. Ich gehe nämlich in vierzehn Tagen auch an Bord eines Schiffes. Auf die „Bella Auranta“. Ab Hamburg.“
„Ich weiß“, sagte sie und rückte näher, so dass mir ganz heiß wurde. „Du hast es in dieser Fernsehsendung erwähnt, die neulich abends stattfand. Wo du als erfolgreicher Autor von Reisebüchern vorgestellt wurdest. Machst du die Kreuzfahrt, um ein Buch darüber zu schreiben?“
„Nein“, sagte ich. „Einfach nur, um mir ein bisschen Seeluft um die Nase wehen zu lassen. Und ein paar fremde Städte zu sehen.“
„Ich fand dich gut im Fernsehen“, sie lächelte mich an.
Ich reckte etwas die Brust heraus. Ein bisschen Eitelkeit steckt in mir. Und dass ausgerechnet Stephanie mich gesehen hatte, bauchpinselte mich besonders.
„Ich fahre nicht mit, Paul reist allein“, sagte sie. „Meine Modekette ist so erfolgreich, dass ich expandieren will und deshalb momentan bis zum Hals in der Arbeit stecke. Am Geld liegt’s nicht – ich verdiene mich mit meiner Firma dumm und dämlich. Andererseits hat Paul unbedingt etwas Erholung von seinem stressigen Job nötig. Deshalb haben wir beschlossen, dass er allein verreisen und mal seinen Kopf auslüften soll.“
„Nicht gut!“, sagte ich. „Aber wenn es nicht anders geht.“
„Lässt sich nicht anders machen. Er wird zur selben Zeit auf demselben Kreuzfahrtschiff sein wie du. Und deshalb bin ich heute hergekommen, um dich zu treffen. Nicht wegen unserem toten Sighard. Der war doch eine Pfeife, wenn wir mal ehrlich sein sollen.“ Sie legte mir die Hand auf den Arm.“ Tust du mir einen Gefallen?“
„Natürlich!“ Ich griff nach ihrer Hand. „Ganz egal, was!“ Auch wenn sie älter geworden war – ich wäre auch heute noch für sie aus dem Fenster gesprungen.
Sie sah mich mit ihren blauen Augen an. Sie wusste nicht, was sie damit bewirkte.
„Darf ich euch danken, dass ihr gekommen seid?“ Die Witwe stand plötzlich neben uns. Wir versicherten ihr, dass es eine Selbstverständlichkeit gewesen sei und wechselten noch einige Worte. Dann ging sie zu anderen Trauergästen, die herumstanden und noch miteinander redeten.
„Kommt ihr mit ein Bier trinken?“ Lehmholz, unser Streber. Er hatte noch zwei andere mitgebracht. Ein Pärchen.
„Tut uns Leid“, sagte ich. „Aber wir haben noch etwas vor.“
Ich hatte „wir“ gesagt. Aber das war wohl richtig. Denn Stephanie trat dicht an mich heran. „Lass es uns auf dem Weg zu unseren Autos besprechen…“
Ihr weißer Audi A6 stand in der hintersten Reihe auf dem staubigen Parkplatz, ein ganzes Stück von meinem Golf entfernt. Ich begleitete sie bis zu ihrem Wagen. Dort blieb sie stehen.
„Kannst du ein Auge auf Paul werfen, wenn ihr auf dem Schiff seid?“ Sie warf mir einen bittenden Blick zu.
„Hast du Angst, dass er sich eine andere anlacht, wenn du nicht dabei bist?“ Ich grinste, aber sie schüttelte den Kopf.
„Nein, es ist so, wie du sagtest – zwischen Paul und mich passt kein Blatt Papier. Im Prinzip führen wir die ideale Ehe. Wir lieben uns, wir achten uns und jeder von uns ist immer für den anderen da.“
„Was ist es dann?“ Ich lehnte mich an die Motorhaube ihres Audi, nahm aber sofort davon wieder Abstand, weil sich das nicht gehört. Jedenfalls nicht bei fremden Autos. Beim eigenen ist es eine lässige Geste. Als ich mich umsah, bemerkte ich hinter den Grabsteinen hinter dem Friedhofszaun einen Mann um die Fünfzig, der mit einem Fotoapparat exakt unsere Richtung anpeilte. Er entdeckte, dass ich ihn gesehen hatte und richtete das Objektiv auf eine große Engelsfigur, mit der Angehörige ihrem verstorbenen Familienmitglied ein Denkmal gesetzt hatten.
„Entschuldige, Steph“, sagte ich. „Ich war abgelenkt. Was hast du eben gesagt?“
Sie wiederholte es. „Paul hat sich verändert. Er ist so…“ Sie suchte nach einem passenden Wort. „Manchmal so eigenartig geworden. Neuerdings so verschlossen. Er wirkt manchmal sehr deprimiert und ratlos.“
„Wirklich keine andere Frau?“ Ich runzelte die Stirn. Bei Frauen ist es einfach zu erkennen, wenn ein Liebhaber auf der Bühne der Ehe erscheint. Sie laufen plötzlich mit einer anderen Frisur herum, versuchen abzunehmen und täuschen oft lange Einkaufsbummel vor, zu denen der dumme Ehemann ohnehin nicht mitgehen will, während sie zu ihrem Herrn Hausfreund eilen. Bei Männern ist das anders. Es sei denn, der träge Gatte wirkt plötzlich sehr agil, zieht sich irre Klamotten aus dem Shop für zwanzig Jahre jüngere Hipster an und kauft sich ein Herrenparfüm.
„Nichts von all dem“, erklärte sie mir. „Ich glaube, sein Job hat ihn ausgelaugt – ich will nicht hoffen, dass er krank ist und es mir verheimlichen will.“ Sie überlegte einen Augenblick. „Manchmal denke ich, er hat Geldsorgen! Du ahnst ja nicht, wie sehr er manchmal darunter leidet, dass er viel weniger verdient als ich. Bildlich gesprochen, denn ich habe ihn immer mitfinanziert. Er war lange arbeitslos und ich glaube, er liebt seinen jetzigen Job nicht besonders. Irgendwann habe ich ihm angeboten, in meiner Kette mitzuarbeiten, aber dafür hatte er kein Händchen.“
„Ich dachte, ihr schwimmt alle beide im Geld“, ich sah sie an. „Du hast doch diese gutgehende Bekleidungsfirma, die eine Menge Kröten abwirft, wie du sagtest, und…“
„Er hat seinen Stolz!“, sagte sie. „Ja, ich habe die Firma. Aber sie gehört mir allein. Vor längerer Zeit haben wir Gütertrennung vereinbart. Haben auch einen Ehevertrag. Damals ging es darum, dass er nicht mit finanziell haftbar wird, falls meine Firma in eine eventuelle Pleite rutscht. Also haben wir das so ausgemacht – ich hab´ meins und er hat seins. Es endete damit, dass ich alles habe und er hat so gut wie nichts mehr auf der Bank. Natürlich hat er von mir Geld bekommen, wenn er in Schwierigkeiten steckte. Und das war oft so. Die Kreuzfahrt kann er sich mit Ach und Krach selbst leisten. Aber große Sprünge kann er trotzdem nicht machen. Kein Wunder, falls er jetzt an Depressionen leiden sollte.“
„Du hast Angst?“ Ich sah sie eindringlich an. „Angst, dass er sich etwas antut? Über Bord springt wie neulich dieser Prominente, der…“
„Genauso ist es!“, sie trat so dicht an mich heran, dass ich ihren Atem spürte. „Bitte – pass ein bisschen auf ihn auf. Das ist meine Bitte!“
Ich überlegte. „Weiß er, dass ich auch auf dem Schiff sein werde?“
„Nein, ich habe es ihm nicht erzählt.“
„Nun gut“, sagte ich. „Dann wird das für ihn eine positive Überraschung sein!“
Und ich genoss den Kuss, den sie mir aus Dankbarkeit auf die Wange hauchte.
„Sie sehen gut aus, Turner!“, sagte der sehr alte Mann mit dem faltigen Gesicht, den man beim Dienst „das Urgestein“ nannte. Er war schon seit Ewigkeiten pensioniert, aber man munkelte, dass er bei der CIA in Langley immer noch manchmal an den Strippen zog. Ihm zur Rechten saß ein kernig aussehender Jüngerer namens Bride mit kurz geschnittenem Haar, leicht gebräunt, mit einem kantigen Gesicht. Beide Männer trugen saloppe Kleidung, helle Sommerhosen und gut gebügelte Oberhemden. Sie blickten Turner an der anderen Seite des Tisches an. Daneben saß noch ein Mann, etwa Fünfzig, in dunklem Anzug, der förmlich aus allen Poren nach Geheimdienst roch.
„Danke!“, erwiderte Turner und sah sich um. „Hübsch haben Sie es hier!“
Der ironische Unterton war nicht zu überhören und er war angebracht, denn der Raum im Keller des vierstöckigen Bürogebäudes war ausgesprochen ungemütlich. Die dicken Wände hatte man ebenso wie die Decke und den Fußboden mit Metallgeflecht versehen, damit keine elektronischen Signale nach innen und auch nicht nach draußen dringen konnten. Um vertrauliche Dinge auszubrüten und zu besprechen, war dieses Zimmer absolut abhörsicher gestaltet worden. Es gab da noch ein paar Spielchen, mit denen der Raum abgesichert worden war, und hier waren schon eine ganze Reihe von Schweinereien ausgeheckt oder vertuscht worden, von denen die amerikanische Öffentlichkeit bis heute nie etwas erfahren hatte. Selbstredend mussten Handys und Laptops draußen im Vorraum abgegeben werden und jeder, der diesen Raum betrat, wurde zuvor noch einmal elektronisch durchgecheckt und durch einen Scanner getrieben. Diejenigen, die das Zimmer im Keller kannten, und das waren die wenigsten im Dienst, nannten es „der Sarg“, weil hier Geheimnisse besprochen wurden, die man besser mit ins Grab nahm.
Читать дальше