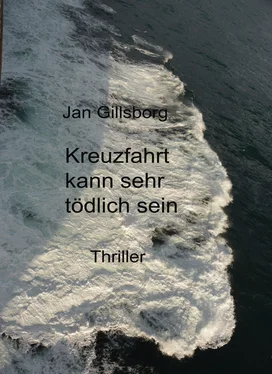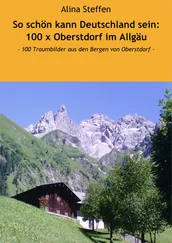Ich bin zu alt für so eine Schinderei, dachte George, als er sich mit dem Toten auf der Schulter zu diesem Grundstück hinüber quälte. Seine Arme schmerzten und sein Herz schlug heftig angesichts der Anstrengung. Doch er schaffte es, auf das nicht abgesperrte Areal zu gelangen und den Körper des Erschossenen über eine der hohen Verschalungen hinab in ein tiefes Loch zu werfen. Schwer atmend verharrte er danach. Er schnappte heftig nach Luft. Dann warf er die Glock17 hinterher, nachdem er mit einem Taschentuch und dem Desinfektionsmittel aus seinem Rucksack alle Fingerabdrücke beseitigt hatte. Aufs Schiff konnte er die Waffe ja doch nicht mitnehmen wegen der Sicherheitskontrollen im Cruise Terminal.
Minuten später war er auf dem Weg zurück zum Kreuzfahrtschiff. Sein Herz schlug immer noch wild und unregelmäßig. Er bekam kaum noch Luft. Im linken Arm verspürte er ein unangenehmes schmerzliches Ziehen, das bis in seine Finger reichte. Für Sekunden verschwamm ihm alles vor den Augen.
Er fühlte sich auch nicht viel besser, als er endlich wieder an Bord der „Bella Auranta“ angekommen war.
Vielleicht sollte ich etwas zu mir nehmen, dachte er. Dann geht es mir wieder besser. Einen kleinen Snack, eine Cola. Ja, das würde helfen. Es war ein bisschen viel gewesen für einen alten Mann um die Siebzig. Aber er wollte noch mindestens zwanzig Jahre leben und zwar in guten finanziellen Verhältnissen. Dazu musste er die „Ware“ nur noch verkaufen. Ihm war egal, wer sie bekam – der Meistbietende würde den Zuschlag bekommen. Die Amerikaner. Oder die Russen. Für beide Seiten war das brisante Material hochinteressant.
Auf der „Bella Auranta“ gab es auf Deck 5 ein kleines Buffet „24 h“, das rund um die Uhr geöffnet hatte. George beschloss, nicht sofort in seine Kabine 9272 zu gehen, sondern zuvor noch das Restaurant zu besuchen. Es war nicht sehr voll, aber acht schlaflose Passagiere hatten sich trotz der späten oder besser: frühen Stunde hier niedergelassen, um sich etwas vom Tresen zu holen.
George versuchte tief Luft zu holen, aber das klappte nicht. Er hatte das Gefühl, dass sich eine Schraubzwinge um seinen Brustkorb zwängte und auch sein Magen nicht in Ordnung war. Deshalb entschied er sich, zuerst eine Schüssel Hühnerbrühe zu sich zu nehmen – hinterher konnte es dann noch etwas Deftiges sein.
Er setzte sich an einen Tisch im Hintergrund. Schob die Schüssel zu sich heran. Griff zum Löffel.
In diesem Augenblick schoss ein so heftiger Schmerz durch seine Brust, wie er ihn noch nie empfunden hatte. Es zerriss ihn fast. Er stöhnte auf. Die Tischplatte schien ihm plötzlich entgegenzukommen.
George fiel mit dem Gesicht so heftig in die heiße Hühnerbrühe, dass es nur so spritzte.
Es machte ihm nicht aus. Denn der Löffel fiel ihm aus der Hand.
Endgültig!
Sighard Höhne wurde an einem trüben Tag im Mai begraben. Wir waren zwölf Studienkameraden von ihm, die auf dem kleinen Friedhof im Norden Berlins zusammengekommen waren, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ehrlich gesagt, gehe ich immer weniger gern zu Begräbnissen, je älter ich werde. Die Totengräber sehen einen stets so eindringlich an, als sei man bald der Nächste, und die meisten Trauergäste taxieren sich auch schon untereinander, wer denn bald an der Reihe sein könnte.
Unser Freund Sighard war auf unkonventionelle Art und Weise aus dem Leben gegangen. Der Tod, ein humoriger Geselle, hatte ihn in der verkehrsarmen Zeit in der Berliner S-Bahn zwischen Pankow und Schönefeld zu sich genommen – auf stille Weise, völlig unbemerkt. Ein Herzschlag, und wie der Notarzt später meinte: ein schöner Tod. Niemand von den wenigen Fahrgästen, die zu dieser Zeit unterwegs waren, hatte davon etwas bemerkt und sich daran gestört, dass Sighard mit geschlossenen Augen auf einem Ecksitz des Wagens vor sich hin ruhte. Da macht einer ein Nickerchen, werden die meisten, die ihn überhaupt gesehen hatten, gedacht haben. Sighards Leichnam musste etwas zwei-, dreimal die ganze lange Strecke hin und hergefahren sein, ehe zwei Fahrkartenkontrolleure am Ostkreuz zustiegen. Um Sighard aus seinem tiefen Schlaf zu wecken, damit er ihnen sein Ticket zeigen könne, rüttelte ihn einer der Kontrolleure an der Schulter. „Aufwachen, guter Mann“, sagte er freundlich. Da fiel Sighard zur Seite und gleich darauf vom Sitz.
Seine etwas dominante Frau, unter der Sighard zu Lebzeiten arg gelitten hatte, setzte zwei Wochen später eine Todesanzeige in die „Berliner Zeitung“, die mit der treffenden Zeile „Erlöst!“ begann. So erfuhren wir von seinem Hinscheiden, telefonierten miteinander, und wer von seinen Studienkameraden in Berlin wohnte, kam zu Trauerfeier und Begräbnis auf den Friedhof, um von unserem Freund Abschied zu nehmen. Ich will nicht auf die Grabrede eingehen, die ein professioneller Trauerredner hielt – bekanntlich wird bei Begräbnissen, was die Toten betrifft, unheimlich gelogen. Hier wurde Sighard als ein Muster von Mensch dargestellt, als engelsgleiche Gestalt, als bienenfleißiger Mensch und stets treuer Ehemann. Von seinen heimlichen Affären und seiner Liebe zum Alkohol sagte der Redner nichts und es dröhnte auch keine Stimme vom Himmel, als er die wundervolle harmonische Ehe pries, über die sich Sighard uns gegenüber bei den regelmäßigen Studententreffen jämmerlich beklagt hatte.
Als Lied zum Abschluss der Trauerfeier hatte sich Sighard in seinem vorsorglich angefertigten Testament „Wär’ heut’ mein letzter Tag“ von Helene Fischer gewünscht – da ging leider etwas schief. Sie hatten zwar die richtige CD eingelegt, aber erwischten das falsche Lied. „Mein Herz schlägt Marathon“, dröhnte es durch die Trauerhalle. Die Witwe lief vor Wut blaurot an, einige Trauergäste grinsten unverhohlen und legten ihre Smartphones weg, mit denen sie während der ganzen Feierlichkeit gespielt hatten. Dann brach der Schlager ab und es kam doch noch das richtige Lied. Aber irgendwie war die Trauerfeier versaut.
Gott sei dank passierte dann beim Einbetten der Urne in die Erde nichts mehr. Niemand ließ sie fallen, die Asche blieb drinnen, wo sie war und die Totengräber verschlossen auch die Grabstelle erst, nachdem wir alle noch eine Weile in stillem Gedenken verharrt hatten.
Ich verabschiedete mich gerade von einigen meiner Studienkameraden, als Stephanie zu mir trat. Stephanie Schönlein, wie sie seit der Hochzeit mit Paul hieß – ihr Familienname war Programm. Sie war einst Schwarm aller männlichen Mitstudenten gewesen, nicht nur unseres Studienjahres. Jetzt hatte sie keine dunklen langen Haare mehr, sondern einen blonden Bob. Ins ovale, angenehme Gesicht mit den veilchenblauen Augen hatten sich ein paar feine Fältchen eingenistet, aber ihr Lächeln öffnete wie früher sofort mein Herz.
„Schön, dass du hier bist, Tom!“ Sie trat näher und drückte mich lange, ehe sie wieder einen Schritt zurücktrat, so dass ich sie mustern konnte. Toll sah sie aus in ihrem schwarzen Mantel, der sicher eine Stange Geld gekostet hatte und nicht aus dem Kaufhaus von der Stange stammte. Teure Stiefel, hohe Absätze, am Arm ein Goldreif, der zu sehen war, wenn sich der Ärmel ihres Mantels zurückschob.
„Auch ich freue mich dich zu sehen, Steph“, sagte ich. „Mein Gott – wie lange ist das her! Bei den letzten Treffen warst du ja nie dabei.“
„Ich hatte zuviel zu tun. Hatte doch vor unendlich vielen Jahren eine kleine Bekleidungsfirma gegründet, die meine ganze Zeit auffrisst, und da war nie Platz für etwas anderes.“
„Bist du immer noch mit Paul verheiratet?“, fragte ich neugierig. „Von euch hört man ja nicht viel. Wo ist er denn? Warum ist er nicht hier?“ Ich wollte nicht das Schlimmste vermuten. „Habt ihr euch etwa getrennt oder geht eure Ehe gar den Bach hinunter? Ihr wart doch seit dem Studium so eng miteinander, dass kein Blatt Papier zwischen euch passte.“
Читать дальше